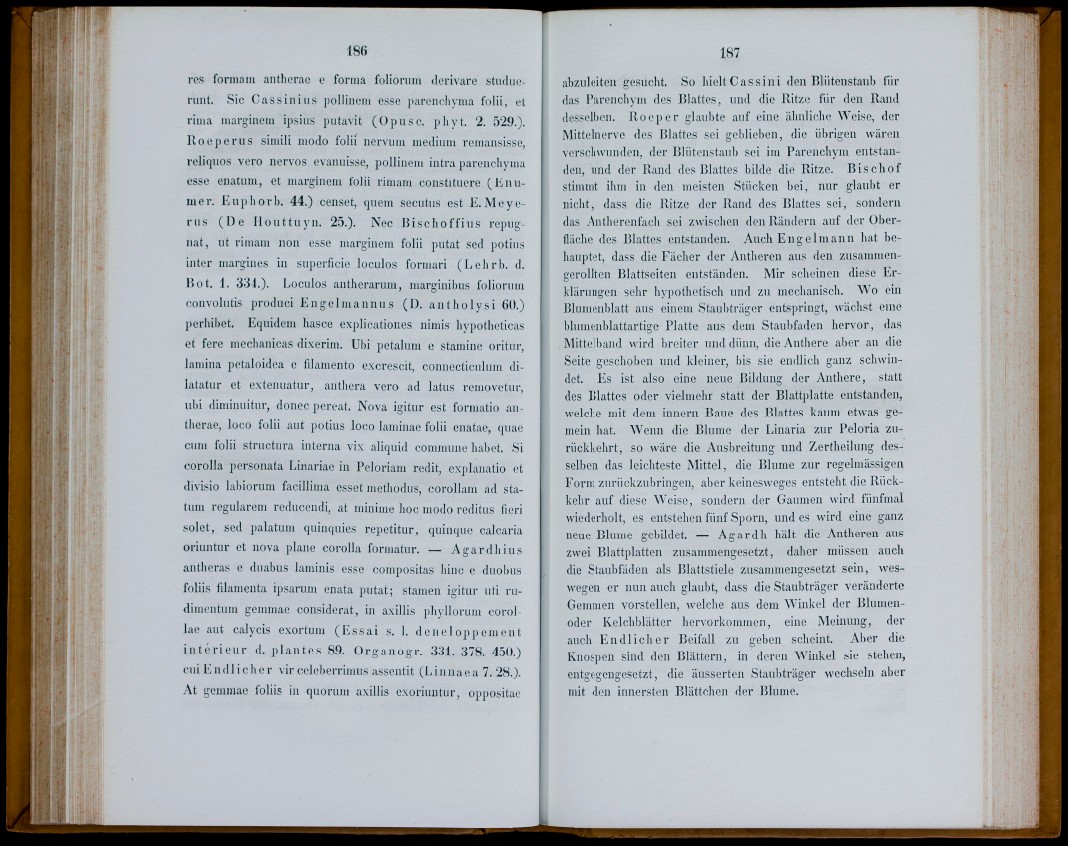
I
i m i ;
Ì '
> i
» •
1 1-
1 ^
h ' . '
a« ! .
tr - >
il
: 4
res forinam antherao o forma foliorum derivare stiuluerunt.
Sic Cas s in i us pollinein esse parenchyma folii, et
rima marginem ipsius putavit (Opuse, pliyt. 2, 529.).
R o e p e r u s simili modo folii nervum medium remansisse,
reliquos vero ñervos evanuisse, polliuem intra parenchyma
esse enatum, et marginem folii rimam constituere (Enume
r. Euphorb. 44.) censet, quem secutus est E. Meyer
u s (De Ilouttuyn. 25.). Nec Bischoffius répugnât,
ut rimam non esse marginem folii putat sed potius
inter margines in superficie loculos formari (Lehrb. d.
Bot. 1. 334.). Loculos antherarum, marginibus foliorum
convolutis produci Engel m a n n u s (D. antholysi 60.)
perhibet. Equidem hasce explicationes nimis hypotheticas
et fere mechanicas dixerim. Ubi petalum e stamine oritur,
lamina petaloidea e filamento excrescit, connecticulum dilatatur
et extenuatur, anthera vero ad latus removetur,
ubi diminuitur, donee pereat. Nova igitur est formatio autherae,
loco folii aut potius loco laminae folii enatae, quae
cum folii structura interna vix aliquid commune habet. Si
corolla personata Linariae in Peloriam redit, explanatio et
divisio labiorum facillima esset methodus, corollam ad statum
regulärem reducendi, at minime hoc modo reditus fieri
solet, sed palatum quinquies repetitur, quinqué calcaria
oriuntur et nova plane corolla formatur. — Agardhius
antheras e duabus laminis esse compositas liinc e duobus
foliis filamenta ipsarum enata putat; stamen igitur uti nidimentum
gemmae considérât, in axillis phyllorum corollae
aut calycis exortum (Essai s. 1. deneloppement
i n t é r i e u r d. p l ant e s 89. Organogr. 331. 378. 450.)
cui E n d l i c h e r vir celeberrimus assentii (Linnaea 7. 28.).
At gemmae foliis in quorum axillis exoriuntur^ oppositae
abzuleiten gesucht. So hielt C a s s i n i den Blütenstaub für
das Farenchym des Blattes, luid die Ritze für den Rand
desselben. Roeper glaubte auf eine ähnliche Weise, der
Mittelnerve des Blattes sei geblieben, die übrigen wären
verschwTuulen, der Blütenstaub sei im Parenchym entstanden,
und der Rand des Blattes bilde die Ritze. Bischof
stimmt ihm in den meisten Stücken bei, nur glaubt er
nicht, dass die Ritze der Rand des Blattes sei, sondern
(las Antherenfach sei zwischen den Rändern auf der Oberfläche
des Blattes entstanden. Auch E n g e lma n n hat behauptet,
dass die Fächer der Antheren aus den zusammengerollten
Blattseiten entständen. Mir scheinen diese Erklärungen
sehr hypothetisch und zu mechanisch. Wo ein
Blumenblatt aus einem Staubträger entspringt, wächst euie
blumenblattartige Platte aus dem Staubfaden hervor, das
Mittelband wird breiter und dünn, die Anthere aber an die
Seite geschoben und kleiner, bis sie endlich ganz schwindet.
Es ist also eine neue Bildung der Anthere, statt
des Blattes oder vielmehr statt der Blattplatte entstanden,
welche mit dem innern Baue des Blattes kaum etwas gemein
hat. Wenn die Blume der Linaria zur Peloria zurückkehrt,
so wäre die Ausbreitung und Zertheilung desselben
das leichteste Mittel, die Blume zur regelmässigen
Form zurückzubringen, aber keinesweges entsteht die Rückkehr
auf diese Weise, sondern der Gaumen wird fünfmal
wiederholt, es entstehen fünf Sporn, und es wird eine ganz
neue Blume gebildet, — Agardh hält die Antheren aus
zwei Blattplatten zusammengesetzt, daher müssen auch
die Staubfäden als Blattstiele zusammengesetzt sein, weswegen
er nun auch glaubt, dass die Staubträger veränderte
Gemmen vorstellen, welche aus dem Winkel der Blumenoder
Kelchblätter hervorkommen, eine Meinung, der
auch Endlicher Beifall zu geben scheint. Aber die
Knospen sind den Blättern, in deren Winkel sie stehen,
entgegengesetzt, die äusserten Staubträger wechseln aber
mit den innersten Blättchen der Blume.
r
]<r
d-fmm
m.