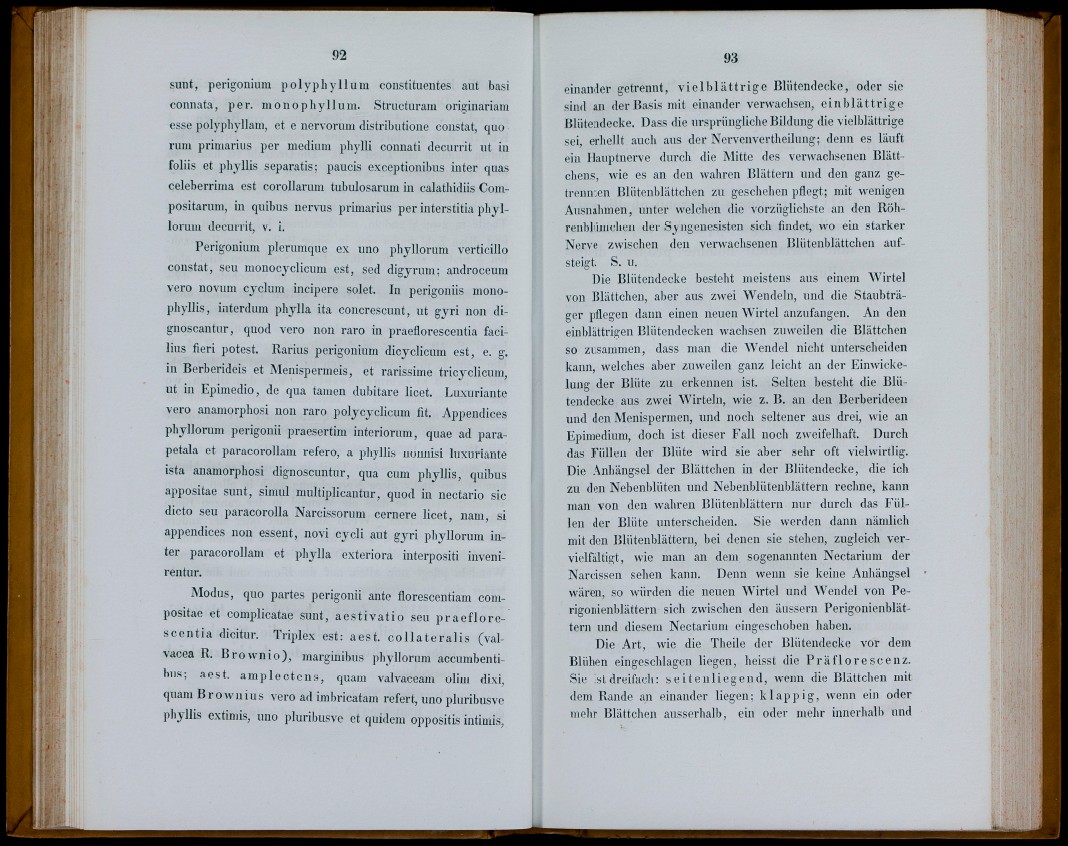
r^-y
P
¥
iV.é
l t : l
Wi-
J .
i
92
sunt, perigonium polyphyllum constituentes aut basi
connata, per. monophyllum. Structuram originariam
esse polyphyllain, et e nervorum distributione constat, quo
rum Primarius per medium phylli connati decurrit ut in
foliis et phyllis separatis; paucis exceptionibus inter quas
celeberrima est corollarum tubulosarum in calathidiis Compositarum,
in quibus nervus primarius per interstitia phj l -
lorum decurrit, v. i.
Perigonium plerumque ex uno pliyllorum verticillo
constat, seu monocjclicum est, sed digjrum; androceum
vero novum cyclum incipere solet. In perigoniis monophyllis,
interdum phjlla ita concrescunt, ut gjri non dignoscantur,
quod vero non raro in praeflorescentia facilius
fieri potest. Rärins perigonium dicjclicnm est, e. g.
in Berberideis et Menispermeis, et rarissime tricyclicum,
ut in Epimedio, de qua tamen dubitare licet. Luxuriante
vero anamorphosi non raro poljcjclicum fit. Appendices
phjllorum perigonii praesertim interiorum, quae ad parapetala
et paracorollam refero, a phyllis nonnisi luxuriante
ista anamorphosi dignoscuntur, qua cum phjllis, quibus
appositae sunt, simul multiplicantur, quod in nectario sic
dicto seu paracorolla Narcissorum cernere licet, nam, si
appendices non essent, novi cjcli aut gyri phyllorum inter
paracorollam et phylla exteriora interpositi invenirentur.
Modus, quo partes perigonii ante florescentiam compositae
et complicatae sunt, aestivatio seu praeflores
c e n t i a dicitur. Triplex est: aest. collateralis (val^
vacea R. Brovvnio), marginibus phyllorum accumbenti^
bus; aest. amplectens, quam valvaceam olim dixi,
quam B r o w ni u s vero ad imbricatam refert, uno pluribusve
phyllis extimis, uno pluribusve et quidem oppositis intimis,
93
einander getrennt, viel b l ä t t r i g e Bliitendecke, oder sie
sind an der Basis mit einander verw^achsen, einblättrige
Blütendecke. Dass die ursprüngliche Bildung die vielblättrige
sei, erhellt auch aus der Nervenvertheilung; denn es läuft
ein Hauptnerve durch die Mitte des verwachsenen Blättchens,
wie es an den wahren Blättern und den ganz getrennten
Bliitenblättchen zu geschehen pflegt; mit wenigen
Ausnahmen, unter welchen die vorzüglichste an den Röhrenblümchen
der Syngenesisten sich findet, wo ein starker
Nerve zwischen den verwachsenen Blütenblättchen aufsteigt.
S. u.
Die Blütendecke besteht meistens aus einem Wirtel
von Blättchen, aber aus zwei Wendeln, und die Staubträger
pflegen dann einen neuen Wirtel anzufangen. An den
einblättrigen Blütendecken wachsen zuweilen die Blättchen
so zusammen, dass man die Wendel nicht unterscheiden
kann, welches aber zuweilen ganz leicht an der Einwickelung
der Blüte zu erkennen ist. Selten besteht die Blütendecke
aus zwei Wirtein, wie z. B. an den Berberideen
und den Menispermen, und noch seltener aus drei, wie an
Epimedium, doch ist dieser Fall noch zweifelhaft. Durch
das Füllen der Blüte wird sie aber sehr oft vielwirÜig.
Die Anhängsel der Blättchen in der Blütendecke, die ich
zu den Nebenblüten und Nebenblütenblättern rechne, kann
man von den wahren Blütenblättern nur durch das Füllen
der Blüte unterscheiden. Sie werden dann nämlich
mit den Blütenblättern, bei denen sie stehen, zugleich vervielfältigt,
wie man an dem sogenannten Nectarium der
Narcissen sehen kann. Denn wenn sie keine Anhängsel
wären, so würden die neuen Wirtel und Wendel von Perigonienblättern
sich zwischen den äussern Perigonienblättern
und diesem Nectarium eingeschoben haben.
Die Art, wie die Theile der Blütendecke vor dem
Blühen eingeschlagen liegen, heisst die P r ä f l o r e scenz.
Sie ist dreifach: sei ten l i e g e n d, wenn die Blättchen mit
dem Rande an einander liegen; k lapp ig, wenn ein oder
mehr Blättchen ausserhalb, ein oder mehr innerhalb und