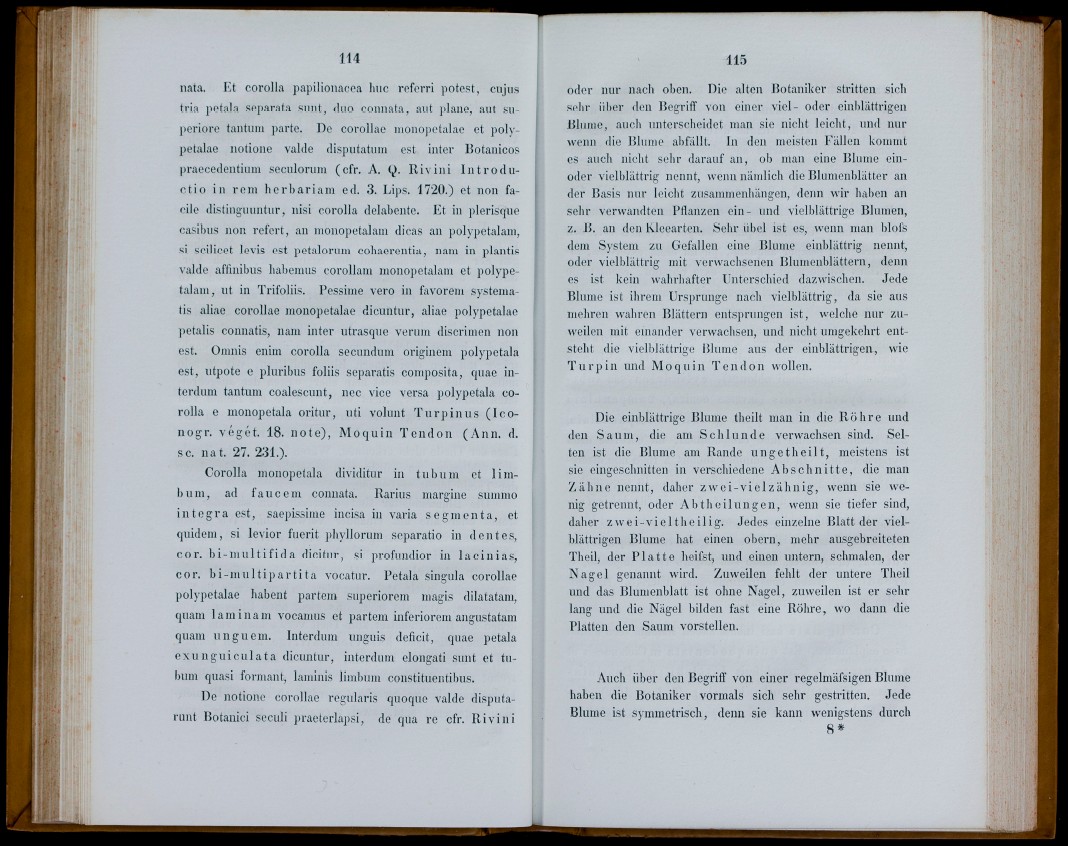
11' »'4 T
114
nata. Et corolla papilionacoa luic roferri potest, cujus
tría pétala separata sunt, duo connata, aut plane, aut su-
[)eriore tcuituni parte. De corollae iuono])etalae et polypetiìlae
notione valde disputatuin est inter Eotanicos
praecedentium seculorum (cfr. A. Q. Riviiii Intreduc
t i o in rem herbariam ed. 3. Lips. 1720.) et non farile
distinguuntur, nisi corolla delabente. Et in plerisque
casibus non refert, an nionopetalam dicas an polypetalani,
si scilicet levis est petalorum cohaerentia, nam in plantis
valde affinibus liabemus corollam monopetalam et polypetalam,
ut in Trifoliis. Pessime vero in favorem systematis
aliae corollae monopetalae dicuntur, aliae polypetalae
]ìetalis connatis, nam inter utrasque verum disciernen non
est. Onmis enim corolla secundum oiéginem polypetala
est, utpote e pluribus foliis separatis composita, quae interdum
tantum coalescunt, nec vice versa polypetala corolla
e monopetala oritur, uti volunt Turpinus (Icon
o g r . v égé i 18. note), Moquin Tendon (Ann. d.
se. nat. 27. 231.).
Corolla monopetala dividitur in tub um et limb
u m, ad f a u c e m connata. Rärins margine summo
i n t e g r a est, saepissime incisa in varia segmenta, et
quidem, si levior fuerit phyllorum separatio in dentes,
c o r . bi-mul t ifida dicitur, si profundior in lacinias,
cor. bi-multipartita vocatur. Pétala singula corollae
polypetalae habent partem superiorem magis dilatatam,
quam lam i n am vocamus et partem inferiorem angustatam
quam unguem. Interdum unguis deficit, quae pétala
e x u n g u i c u l a t a dicuntur, interdum elongati sunt et tubum
quasi formant, laminis limbum constituentibus.
De notione corollae regularis quoque valde disputarunt
Botanici seculi praeterlapsi, de qua re cfr. Ri v ini
115
oder nur nach oben. Die alten Botaniker stritten sich
sehr über den Begriff von einer viel- oder einblättrigen
Blume, auch unterscheidet man sie nicht leicht, und nur
wenn die Blun»e abfällt. In den meisten Fällen kommt
es auch nicht sehr darauf an, ob man eine Blume einoder
vielblättrig nennt, wenn nämlich die Blumenblätter an
der Basis nur leicht zusammenhängen, deim wir haben an
sehr verwandten Pflanzen ein- und vielblättrige Blumen,
z, B. an den Kleearten. Sehr übel ist es, wenn man blofs
dem System zu Gefallen eine Blume einblättrig nennt,
oder vielblättrig mit verwachsenen Blumenblättern, denn
es ist kein wahrhafter Unterschied dazwischen. Jede
Blume ist ihrem Ursprünge nach vielblättrig, da sie aus
mehren wahren Blättern entsprungen ist, welche nur zu-
Aveilen mit emander verwachsen, und nicht umgekehrt entsteht
die vielblättrige Blume aus der einblättrigen, wie
T u r p i n und Moqui n Tendon wollen.
Die einblättrige Blume theilt man in die R ö h r e und
den Saum, die am Schlünde verwachsen sind. Selten
ist die Blume am Rande ungetheilt, meistens ist
sie eingeschnitten in verschiedene Abschni t te, die man
Z ä h n e nennt, daher zwei -vielzähnig, wenn sie wenig
getrennt, oder Abthei lungen, wenn sie tiefer sind,
daher zwei-vieltheilig. Jedes einzelne Blatt der vielblättrigen
Blume hat einen obern, mehr ausgebreiteten
Theil, der P l a t t e heifst, und einen untern, schmalen, der
N a g e l genannt wird. Zuweilen fehlt der untere Theil
und das Blumenblatt ist ohne Nagel, zuweilen ist er sehr
lang und die Nägel bilden fast eine Röhre, wo dann die
Platten den Saum vorstellen.
Auch über den Begriff von einer regelmäfsigen Blume
haben die Botaniker vormals sich sehr gestritten. Jede
Blume ist symmetrisch, denn sie kann wenigstens durch
il
Ii
• .'j