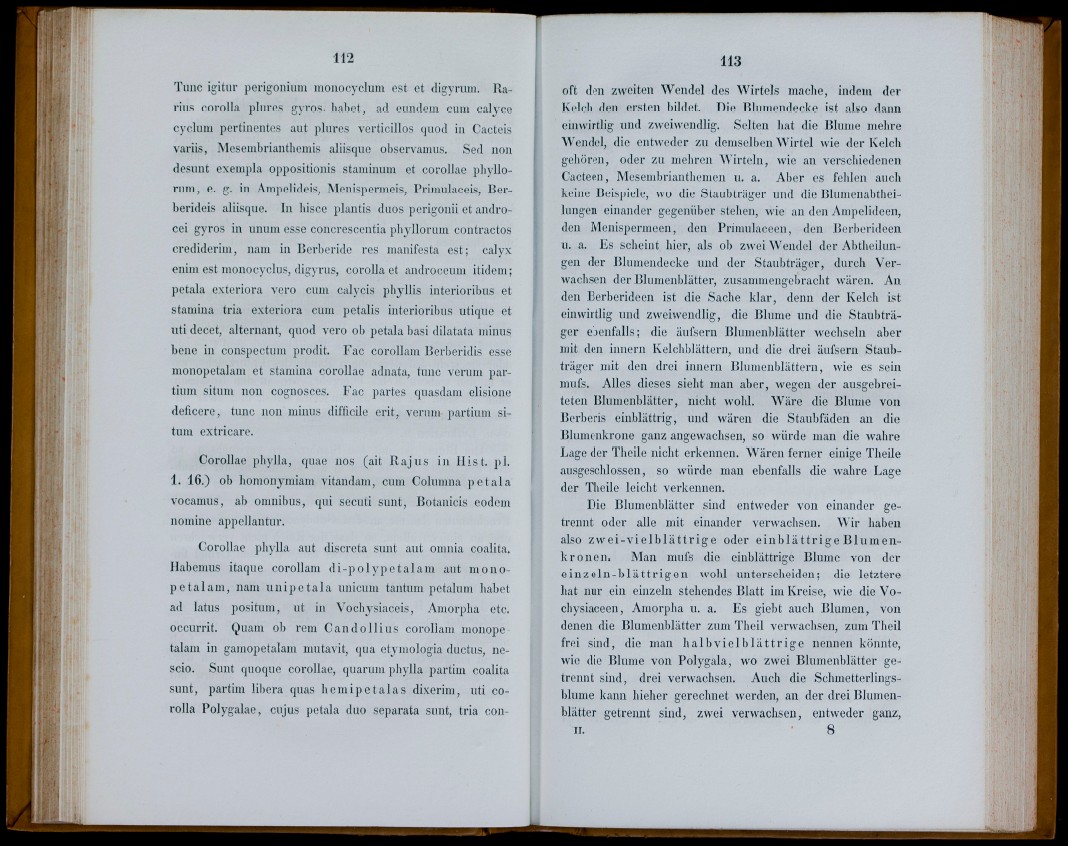
' î
J,
Uli m.
i
II
• ri
î •Jär;;"il
.i'i
112
Tunc igitur perigoniuiu inoiiocycluiu est et dig^/rimi. Rärins
corolhx plurcs gyros, habet, ad cundem cum calyce
cycliim pertiiientes aut plures verticillos quod in Cacteis
variis, Mesembriaiithemis aliisque observamus. Sed nou
desunt exempla oppositionis staminiim et corollae phylloriiiu,
e. g. in Ampelideis, Mcnispermeis, Priniulaceis, Berberideis
aliisque. In bisce phxntis dnos perigonii et andròcei
gyros in nnum esse concresceutia pliyllorum contractos
crediderim, nam in Berberide res manifesta est; calyx
enim est monocyckis, digyrus, coi'olla et androcenm itidem;
petala exteriora vero cnm c¿llycis phyllis interioribns et
stamina tria exteriora cum petalis interioribns utiqne et
liti decet, alternant, quod vero ob petala basi dilatata minus
bene in conspectuìu prodit. Fac corollam IJerberidis esse
monopetalam et stamina corollae adnatci, tunc verum partium
situm non cognosces. Fac partes quasdam elisione
deficere, tunc non minus difficile erit^ verum partium situm
extricare.
Corollae pbylla, quae nos (ait Kajus in Ilist. pl.
1. 16.) ob liomonymiam vitandam, cum Colmuna petala
vocamus, ab omnibus, qui secuti sunt, Botanicis eodem
nomine appellantur.
Corollae pbylla aut discreta sunt aut omnia coalita*
Ilabemus itaque corollam di-polypetalam aut monop
e t a l a m , nam unipetal a unicum tantum petalum habet
ad latus positum, ut in Vochysiaceis, Amorpha etc.
occurrit. Quam ob rem Candollius cox'ollam monopetalam
in gamopetalam mutavit, qua etymologia ductus, nescio.
Sunt quoque corollae, quarum phylla partim coalita
sunt, partim libera quas hemipetalas dixerim, uti corolla
Polygalae, cujus petala duo separata sunt, tria con-
113
oft den zweiten Wendel des Wirteis mache, indem der
Kelcli den ersten bildet. Die Blumendecke ist also dann
einwirtlig und zvveivvendlig. Selten hat die Blume mehre
Wendel, die entweder zu demselben Wirtel wie der Kelch
gehören, oder zu mehren Wirtein, wie an verschiedenen
Cacteen, Mcsembi^ianthemen u. a. Aber es fehlen auch
keine Beispiele, wo die Staubträger und die Blumenabtheilungen
einander gegenüberstehen, wie an den Ampelideen,
den Menispermeen, den Prmiulaceen, den Berberideen
II. a. Es scheint hier, als ob zwei Wendel der Abtheilungen
der Blumendecke und der Staubträger, durch Verwachsen
der Blumenblätter, zusammengebracht wären. An
den Berberideen ist die Sache klar, denn der Kelch ist
einwirtlig und zweiwendlig, die Blume und die Staubträger
ebenfalls; die äufsern Blumenblätter wechseln aber
mit den innern Kelchblättern, und die drei äufsern Staubträger
mit den drei innern Blumenblättern, wie es sein
mufs. Alles dieses sieht man aber, wegen der ausgebreiteten
Blumenblätter, nicht wohL Wäre die Blume von
Berberis einblättrig, und wären die Staubfäden an die
Blumenkrone ganz angewachsen, so würde man die wahre
Lage der Theile nicht erkennen. Wären ferner einige Theile
ausgeschlossen, so würde man ebenfalls die wahre Lage
der Theile leicht verkennen.
Die Blumenblätter sind entweder von einander getrennt
oder alle mit einander verwachsen. Wir haben
also zwei -vielblät t r ige oder einblät trige Blumenk
r o n e n . Man mufs die einblättrige Blume von der
e i n z e l n - b l ä t t r i g e n wohl unterscheiden ; die letztere
hat nur ein einzeln stehendes Blatt im Kreise, wie die Vochysiaceen,
Amorpha u. a. Es giebt auch Blumen, von
denen die Blumenblätter zum Theil verwachsen, zum Theil
frei sind, die man halb v i e l b l ä t t r i g e nennen könnte,
wie die Blume von Polygala, w^o zwei Blumenblätter getrennt
sind, drei verwachsen. Auch die Schmetterlingsblume
kann hieher gerechnet werden, an der drei Blumenblätter
getrennt sind, zwei verwachsen, entweder ganz.
Vi': 'Ti I ' l. "'„If- ìimM , 1 ,
IL 8