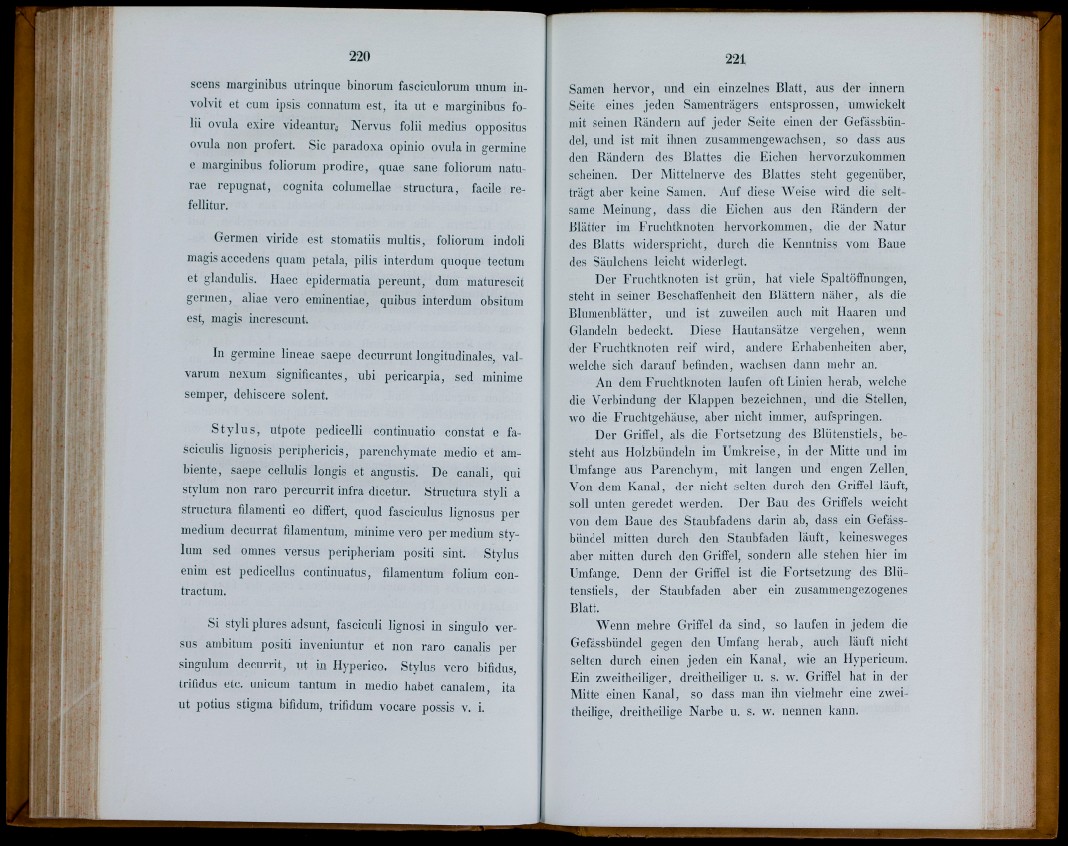
h il /
I';
i•1: p•• . Vi:•
If.
220
sceiis margiiùbus utrinque binorum fasciculorum unum involvit
et cum ipsis connatum est, ita ut e marginibus foli!
ovula exire videautur^ Nervus folii médius oppositus
ovula non proferì. Sic paradoxa opinio ovula in germine
e marginibus foliorum prodire, quae sane foliorum naturae
répugnât, cognita columellae structura, facile refellitur.
Germen viride est stomatiis multis, foliorum indoli
magis accedens quam pétala, pilis interdum quoque tectum
et glandulis. Haec epidermatia pereunt, dum maturescit
germen, aliae vero eminentiae, quibus interdum obsitum
est, magis increscunt.
In germine lineae saepe decurrunt longitudinales, valvarum
nexum significantes, ubi pericarpia, sed minime
semper, dehiscere soient.
S t y l u s , utpote pedicelli continuatio constat e fasciculis
lignosis periphericis, parencliymate medio et ambiente,
saepe cellulis longis et angustis. De canali, qui
stylum non raro percurrit infra dicetur. Structura styli a
structura filamenti eo diflfert, quod fasciculus lignosus per
medium decurrat filamentum, minime vero per medium stylum
sed omnes versus peripheriam positi sint. Stylus
enim est pedicellus continuatus, filamentum folium contractum.
Si styli plures adsunt, fasciculi lignosi in singulo versus
ambitum positi inveniuntur et non raro canalis per
singulum decurrit, ut in Hyperico. Stylus vero bifidus,
trifidus etc. unicum tantum in medio liabet canalem, ita
ut potius stigma bifidum, trifidum vocare possis v. i.
(Il, ,,
221
Samen hervor, und ein einzelnes Blatt, aus der innern
Seite eines jeden Samenträgers entsprossen, umwickelt
mit seinen Rändern auf jeder Seite einen der Gefässbünde],
und ist mit ihnen zusammengewachsen, so dass aus
den Rändern des Blattes die Eichen hervorzukommen
scheinen. Der Mittelnerve des Blattes steht gegenüber,
trägt aber keine Samen. Auf diese Weise wird die seltsame
Meinung, dass die Eichen aus den Rändern der
Blätter im Fruchtknoten hervorkommen, die der Natur
des Blatts widerspricht, durch die Kenntniss vom Baue
des Säulchens leicht widerlegt.
Der Fruchtknoten ist grün, hat viele Spaltöffnungen,
steht in seiner Beschaffenheit den Blättern näher, als die
Blumenblätter, und ist zuweilen auch mit Haaren und
Glandeln bedeckt. Diese Hautansätze vergehen, wenn
der Fruchtknoten reif wird, andere Erhabenheiten aber,
welche sich darauf befinden, wachsen dann mehr an.
An dem Fruchtknoten laufen oft Linien herab, welche
die Verbindung der Klappen bezeichnen, und die Stellen,
w^o die Fruchtgehäuse, aber nicht immer, aufspringen.
Der Griffel, als die Fortsetzung des Blütenstiels, besteht
aus Holzbündeln im Umkreise, in der Mitte und im
Umfange aus Parenchym, mit langen und engen Zellen.
Von dem Kanal, der nicht selten durch den Griffel läuft,
soll unten geredet werden. Der Bau des Griffels weicht
von dem Baue des Staubfadens darin ab, dass ein Gefässbündel
mitten durch den Staubfaden läuft, keinesweges
aber mitten durch den Griffel, sondern alle stehen hier im
Umfange. Denn der Griffel ist die Fortsetzung des Blütenstiels,
der Staubfaden aber ein zusammengezogenes
Blatt.
Wenn mehre Griffel da sind, so laufen in jedem die
Gefässbündel gegen den Umfang herab, auch läuft nicht
selten durch einen jeden ein Kanal, wie an Hypericum.
Ein zweitheiliger, dreitheiliger xx. s. w. Griffel hat in der
Mitte einen Kanal, so dass man ihn vielmehr eine zweitheilige,
dreitheilige Narbe u. s. w. nennen kann.