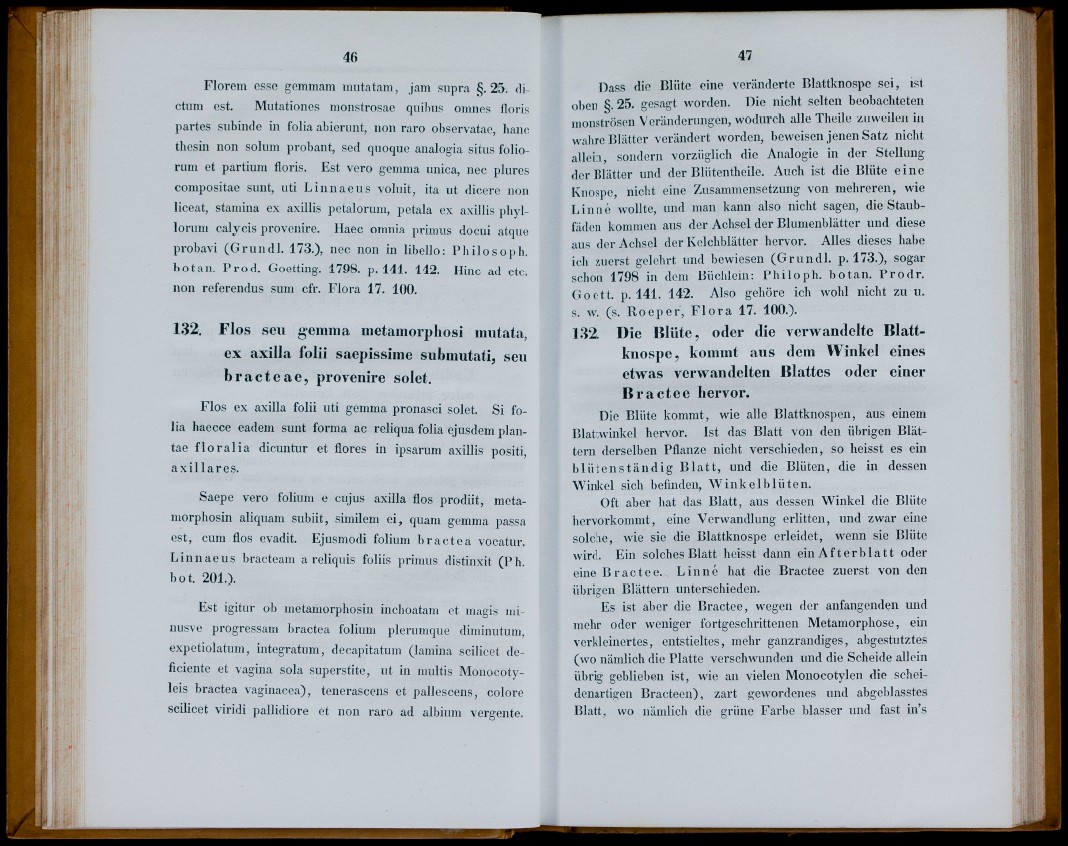
•ìi
1 i i ; . 1 i i l " ilÉjVilf: ,: :
, • Iii'..,,;-;
I Ì
Î
! «. ! '
t
46
Florem esso gommam mutatam, jam supra §.25. dictum
est. Mutationes monstrosac qiiilms omncs iloris
partes subinde in folia abierunt, non raro observatac, liane
thcsin non solum probant, sed quoque analogia situs foliorum
et partium floris. Est vero gemma unica, nec plures
compositae sunt, uti Linnaeus voluit, ita ut dicere non
liceat, stamina ex axillis petalorum, petala ex axillis phyllorum
calycis provenire. Haec omnia primus docui atque
probavi (Gründl. 173.), nec non in libello: Pliilosopli.
botan. Prod. Goetting. 1798. p. 141. 142. Hinc ad etc.
non referendus sum cfr. Flora 17. 100.
132. Flos seil gemma metamorpliosi mutata,
ex axilla folii saepissime submutati, seu
bracteae, provenire solet.
Flos ex axilla folii uti gemma pronasci solet. Si folia
haecce eadem sunt forma ac reliqua folia ejusdem plantae
fior a l i a dicuntur et flores in ipsarum axillis positi,
a x i l l a r e s .
Saepe vero folium e cujus axilla flos prodiit, metamorphosin
aliquam subiit, similem ei, quam gemma passa
est, cum flos evadit. Ejusmodi folium bractea vocatur.
L i n n a e u s bracteam a reliquis foliis primus distinxit (Ph.
bot. 201.).
Est igitur ob metamorphosin inchoatam et magis minusve
progressam bractea folium plerumque diminutum,
expetiolatum, integratum, decapitatum (lamina scilicet deficiente
et vagina sola superstite, ut in multis Monocotyleis
bractea vaginacea), tenerascens et pallescens, colore
scilicet viridi pallidiore et non raro ad albium vergente.
47
Dass die Blüte eine veränderte Blattknospc sei, ist
ol)on §.25. gesagt worden. Die nicht selten beobachteten
monströsen Veränderungen, wodurch alle Theile zuweilen in
wahre Blätter verändert worden, beweisen jenen Satz nicht
allein, sondern vorzüglich die Analogie in der Stellung
der Blätter und der Blütentheile. Auch ist die Blüte eine
Knospe, nicht eine Zusammensetzung von mehreren, wie
Linné wollte, und man kann also nicht sagen, die Staubfäden
kommen aus der Achsel der Blumenblätter und diese
aus der Achsel der Kelchblätter hervor. Alles dieses habe
ich zuerst gelehrt und bewiesen (Gründl, p. 173.), sogar
schon 1798 in dem Büchlein: Philoph. botan. Prodr.
Goett. p. 141. 142. Also gehöre ich wohl nicht zu u.
s. w. (s. Roeper , Flora 17. 100.).
132. Die Blüte, oder die verwandelte Blattknospe,
kommt aus dem Winkel eines
etwas verwandelten Blattes oder einer
Bractee hervor.
Die Blüte kommt, wie alle Blattknospen, aus einem
Blattwinkel hervor. Ist das Blatt von den übrigen Blättern
derselben Pflanze nicht verschieden, so heisst es ein
b l ü t e n s t ä n d i g Blatt, und die Blüten, die in dessen
Winkel sich befinden, Winkelblüten.
Oft aber hat das Blatt, aus dessen Winkel die Blüte
hervorkommt, eine Verwandlung erlitten, und zwar eine
solche, wie sie die Blattknospe erleidet, wenn sie Blüte
wird. Ein solches Blatt heisst dann ein A f t e r b l a t t oder
eine Bractee. . Linné hat die Bractee zuerst von den
übrigen Blättern unterschieden.
Es ist aber die Bractee, wegen der anfangenden und
mehr oder weniger fortgeschrittenen Metamorphose, ein
verkleinertes, entstieltes, mehr ganzrandiges, abgestutztes
(wo nämlich die Platte verschwunden und die Scheide allein
übrig geblieben ist, wie an vielen Monocotylen die scheidenartigen
Bracteen), zart gewordenes und abgeblasstes
Blatt, wo nämlich die grüne Farbe blasser und fast in's
'•r iil:» r1lVi'.ï-
• i t E
•ii
m
: . 'J
.1 ih .^^V
.é