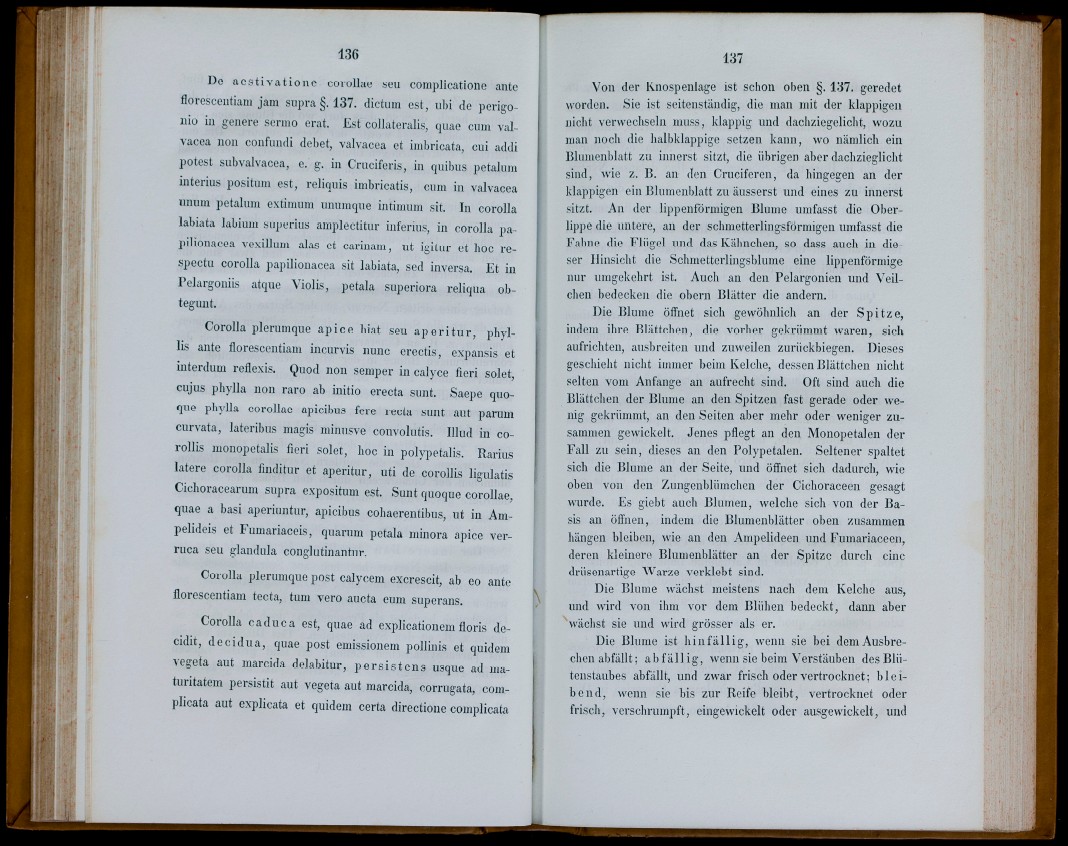
136
De aestivationc corollae seu complicatione ante
florescentiani jam supra §. 137. dictum est, ubi de perigonio
ill genere senno erat. Est collateralis, quae cum valvacea
non confundi debet, valvacea et imbricata, cui addi
potest subvalvacea, e. g. in Cruciferis, in quibus petalum
interius positum est, reliquis imbricatis, cum in valvacea
unum petalum extimum unumque intimnm sit. In corolla
labiata labium superius amplectitur inferius, in corolla papilionacea
vexillum alas et carinam, ut igitur et hoc respectu
corolla papilionacea sit labiata, sed inversa. Et in
Pelargoniis atque Violis, petala superiora reliqua obtegunt.
Corolla plerumque apice Mat seu aperi tur, phyl-
Iis ante florescentiam incurvis nunc erectis, expansis et
interdum reflexis. Quod non semper in calyce fieri solet,
cujus phylla non raro ab initio erecta sunt. Saepe quoque
pliylla corollae apicibus fere recta sunt aut parum
curvata, lateribus magis minusve convolutis. Illud in corollis
monopetalis fieri solet, hoc in polypetalis. Rarius
latere corolla finditur et aperitur, uti de corollis ligulatis
Cichoracearum supra expositum est. Sunt quoque corollae,
quae a basi aperiuntur, apicibus cohaerentibus, ut in Ampelideis
et Fumariaceis, quarum petala minora apice verruca
seu gianduia conglutinantur.
Corolla plerumque post calycem excrescit, ab eo ante
florescentiam tecta, tum vero aucta eum superans.
Corolla caduca est, quae ad explicationem floris decidit,
decidua, quae post emissionem pollinis et quidem
vegeta aut marcida delabitur, persist ens usque ad maturitatem
persistit aut vegeta aut marcida, corrugata, complicata
aut explicata et quidem certa directione complicata
137
Von der Knospenlage ist schon oben §. 137. geredet
worden. Sie ist seitenständig, die man mit der klappigen
nicht verwechseln muss, klappig und dachziegelicht^ wozu
man noch die halbklappige setzen kann^ wo nämlich ein
Blumenblatt zu innerst sitzt, die übrigen aber dachzieglicht
sind, wie z. B. an den Cruciferen, da hingegen an der
klappigen ein Blumenblatt zu äusserst und eines zu innerst
sitzt. An der lippenformigen Blume umfasst die Oberlippe
die luitere, an der schmetterlingsförmigen umfasst die
Fahne die Flügel und das Kähnchen, so dass auch in dieser
Hinsicht die Schmetterlingsblume eine lippenförmige
nur umgekehrt ist. Auch an den Pelargonien und Veilchen
bedecken die obern Blätter die andern.
Die Blume öffnet sich gewöhnlich an der Spitze,
indem ihre Blättchen, die vorher gekrümmt waren, sich
aufrichten, ausbreiten und zuweilen zurückbiegen. Dieses
geschieht nicht immer beim Kelche, dessen Blättchen nicht
selten vom Anfange an aufrecht sind. Oft sind auch die
Blättchen der Blume an den Spitzen fast gerade oder wenig
gekrümmt, an den Seiten aber mehr oder weniger zusammen
gewickelt. Jenes pflegt an den Monopetalen der
Fall zu sein, dieses an den Polypetalen. Seltener spaltet
sich die Blume an der Seite, und öfi'net sich dadurch, wie
oben von den Zungenblümchen der Cichoraceen gesagt
wurde. Es giebt auch Blumen, welche sich von der Basis
an öffnen, indem die Blumenblätter oben zusammen
hängen bleiben, wie an den Ampelideen und Fumariaceen,
deren kleinere Blumenblätter an der Spitze durch eine
drüsenartige Warze verklebt sind.
Die Blume wächst meistens nach dem Kelche aus,
und wird von ihm vor dem Blühen bedeckt, dann aber
wächst sie und wird grösser als er.
Die Blume ist hinfäl l ig, wenn sie bei dem Ausbrechen
abfällt; abfällig, wenn sie beim Verstäuben des Blütenstaubes
abfällt, und zwar frisch oder vertrocknet; bleibend,
wenn sie bis zur Reife bleibt, vertrocknet oder
frisch, verschrumpft, eingewickelt oder ausgewickelt, und
IIBlill i mi^ma !
f f ? f rr