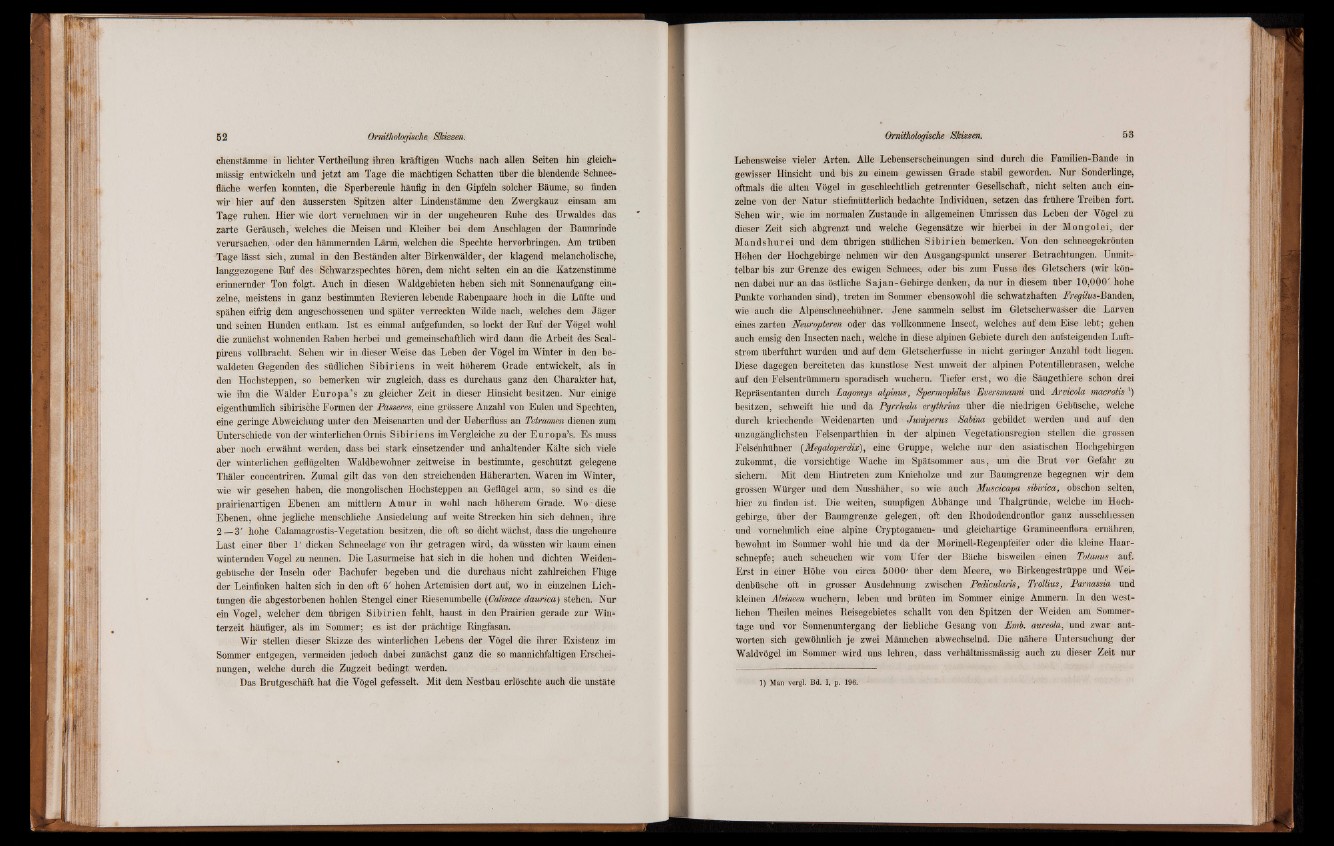
chenstämme in lichter Vertheilung ihren kräftigen Wuchs nach allen Seiten hin gleich-
mässig entwickeln und jetzt am Tage die mächtigen Schatten über die blendende Schnee-
fläche werfen konnten, die Sperbereule häufig in den Gipfeln solcher Bäume, so finden
wir hier auf den äussersten Spitzen alter Lindenstämme den Zwergkauz einsam am
Tage ruhen. Hier wie dort vernehmen wir in der ungeheuren Ruhe des Urwaldes das
zarte Geräusch, welches die Meisen und Kleiber bei dem Anschlägen der Baumrinde
verursachen, oder den hämmernden Lärm, welchen die Spechte hervorbringen. Am trüben
Tage lässt sich, zumal in den Beständen älter Birkenwälder, der klagend melancholische,
langgezogene Ruf des Schwarzspechtes hören, dem nicht selten ein an die Katzenstimme
erinnernder Ton folgt. Auch in diesen Waldgebieten heben sich mit Sonnenaufgang einzelne,
meistens in ganz bestimmten Revieren lebende Rabenpaare hoch in die Lüfte und
spähen eifrig dem angeschossenen und später verreckten Wilde nach, welches dem Jäger
und seinen Hunden entkam. Ist es einmal aufgefunden, so lockt der Ruf der Yögel wohl
die zunächst wohnenden Raben herbei und gemeinschaftlich wird dann die Arbeit des Scal-
pirens vollbracht. Sehen wir in-dieser Weise das Leben der Yögel im Winter in den bewaldeten
Gegenden des südlichen Sibiriens in weit höherem Grade entwickelt, als in
den Hochsteppen, so bemerken wir zugleich, dass es durchaus ganz den Charakter hat,
wie ihn die Wälder E u ro p a ’s zu gleicher Zeit in dieser Hinsicht besitzen. Nur einige
eigenthümlich sibirische Formen der Passeres, eine grössere Anzahl von Eulen und Spechten,
eine geringe Abweichung unter den Meisenarten und der Ueberfluss an Tetramen dienen zum
Unterschiede von der winterlichen Omis Sibiriens im Vergleiche zu der Europa’s. Es muss
aber noch erwähnt werden, dass bei stark einsetzender und anhaltender Kälte sich viele
der winterlichen geflügelten Waldbewohner zeitweise in bestimmte, geschützt gelegene
Thäler concentriren. Zumal gilt das von den streichenden Häherarten. Waren im Winter,
wie wir gesehen haben, die mongolischen Hochsteppen an Geflügel arm, so sind es die
prairienartigen Ebenen am mittlern Amur in wohl nach höherem Grade. Wo diese
Ebenen, ohne jegliche menschliche Ansiedelung auf weite Strecken hin sich dehnen, ihre
2—3' hohe Calamagrostis-Vegetation besitzen, die oft so dicht wächst, dass die ungeheure
Last einer über V dicken Schneelage’von ihr getragen wird, da wüssten wir kaum einen
winternden Yogel zu nennen. Die Lasurmeise hat sich in die hohen und dichten Weidengebüsche
der Inseln oder Bachufer begeben und die durchaus nicht zahlreichen Flüge
der Leinfinken halten sich in den oft 6' hohen Artemisien dort auf, wo in einzelnen Lichtungen
die abgestorbenen hohlen Stengel einer Riesenumbelle (Calisace dauriea) stehen. Nur
ein Vogel, welcher dem übrigen Sibirien fehlt, haust in den Prairien gerade zur Winterzeit
häufiger, als im Sommer; es ist der prächtige Ringfasan.
Wir stellen dieser Skizze des winterlichen Lebens der Vögel die ihrer Existenz im
Sommer entgegen, vermeiden jedoch dabei zunächst ganz die so mannichfaltigen Erscheinungen,
welche durch die Zugzeit bedingt werden.
Das Brutgeschäft .hat die Vögel gefesselt. Mit dem Nestbau erlöschte auch die unstäte
Lebensweise vieler Arten. Alle Lebenserscheinungen sind durch die Familien-Bande in
gewisser Hinsicht und bis zu einem gewissen Grade stabil geworden. Nur Sonderlinge,
oftmals die alten Vögel in geschlechtlich getrennter Gesellschaft, nicht selten auch einzelne
von der Natur stiefmütterlich bedachte Individuen, setzen das frühere Treiben fort.
Sehen wir, wie im normalen Zustande in allgemeinen Umrissen das Leben der Vögel zu
dieser Zeit sich abgrenzt und welche Gegensätze wir hierbei in der Mongolei, der
Mandshurei und dem übrigen südlichen Sibirien bemerken. Von den schneegekrönten
Höhen der Hochgebirge nehmen wir den Ausgangspunkt unserer Betrachtungen. Unmittelbarbis
zur Grenze des ewigen Schnees, oder bis zum Fusse des Gletschers (wir können
dabei nur an das östliche Sajan-Gebirge denken, da nur in diesem über 10,000' hohe
Punkte vorhanden sind), treten im Sommer ebensowohl die schwatzhaften Fregäm-Banden,
wie auch die Alpefrschneehtihner. Jene sammeln selbst im Gletscherwasser die Larven
eines zarten Neuropteren oder das vollkommene Insect, welches auf dem Eise lebt; gehen
auch emsig den Insecten nach, welche in diese alpinen Gebiete durch den aufsteigenden Luft-
strom überführt wurden und auf dem Gletscherfusse in nicht geringer Anzahl todt liegen.
Diese dagegen bereiteten das kunstlose Nest unweit der alpinen Potentilleürasen, welche
auf den Felsentrümmem sporadisch wuchern. Tiefer erst, wo die Säugethiere schon drei
Repräsentanten durch Lagomys alpinus, SpermopMlus Eversmatm und Arvicola macrotis ’)
besitzen, schweift hie und da Pyrrhula erythrim über die niedrigen Gebüsche, welche
durch kriechende 'Weidenarten und Juniperus Salrna gebildet werden und auf den
unzugänglichsten Felsenparthien in der alpinen Vegetationsregion stellen die grossen
Felsenhüfmer (Megaloperdix), eine Gruppe, welche nur .den asiatischen Hochgebirgen
zukommt, die vorsichtige Wache im Spätsommer aus, um die Brut vor Gefahr zu
sichern. Mit dem Wint.ret.en zum Knieholze und zur Baumgrenze begegnen wir dem
grössen Würger und dem Nusshäher, so wie auch Muscicapa sibirica, obschon selten,
hier zu finden ist. Die weiten, sumpfigen Abhänge und Thalgründe, welche im Hochgebirge,
über der Baumgrenze gelegen, oft den Rhododendronflor ganz ausschliessen
und vornehmlich eine alpine Cryptogamen- und gleichartige Gramineenflora ernähren,
bewohnt im Sommer wohl hie und da der Morinell-Regenpfeifer oder die kleine Haarschnepfe;
auch scheuchen wir vom Ufer der Bäche bisweilen einen Totanus auf.
Erst in einer Höhe von circa 5000' über dem Meere,, wo Birkengestrüppe und Weidenbüsche
oft in grösser Ausdehnung zwischen Pedicularis, Trollius, Parmssia und
kleinen Alsineen wuchern, leben und brüten im Sommer einige Ammern. In den westlichen
Theilen meines Reisegebietes schallt von den Spitzen der Weiden am Sommertage
und vor Sonnenuntergang der liebliche Gesang von Emb. aureola, und zwar antworten
sich gewöhnlich je zwei Männchen abwechselnd. Die nähere Untersuchung der
Waldvögel im Sommer wird uns lehren, dass verhältnissmässig auch zu dieser Zeit nur
1) Man vergl. Bd. I, p. 196.