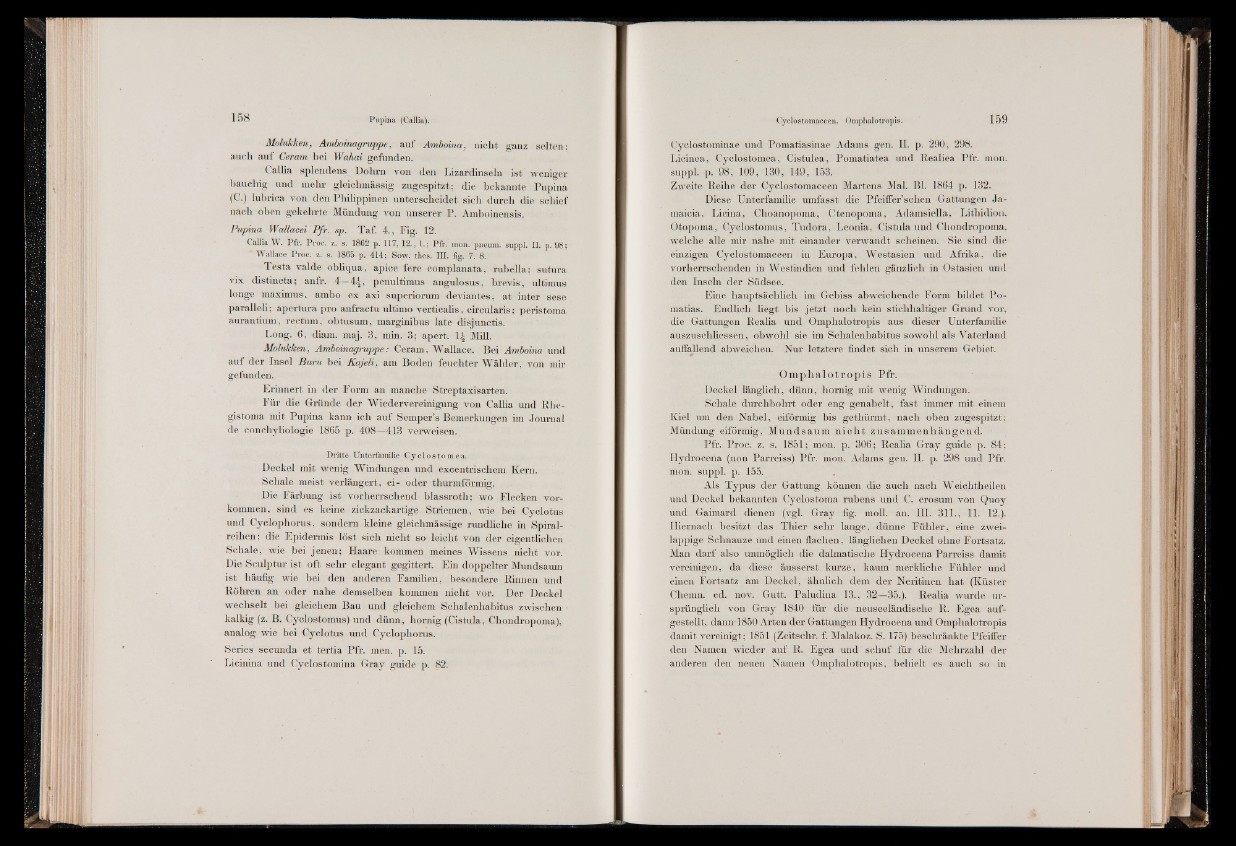
Molukken, Amboinagrwppe, auf Amboina, nicht ganz selten;
auch auf Ceram bei Wahai gefunden.
Callia splendens Dohrn von den Lizardinseln ist weniger
bauchig und mehr gleichmässig zugespitzt; die bekannte Pupina
(C.) lubrica von den Philippinen unterscheidet sich durch die schief
nach oben gekehrte Mündung von unserer P. Amboinensis.
Pwpina Wallacei Pfr. sp. Taf. 4., Fig. 12.
Callia W . Pfr. Proc. z. s. 1862 p. 117, 12., 1.; Pfr. mon. pneum. suppl. II. p. 98;
Wallace Proc. z. s. 1865 p. 414; Sow. thes. DI. flg. 7. 8 .
Testa valde obliqua, apice fere complanata, rubella; sutura
vix distincta; anfr. 4—4%, penultimus angulosus, brevis, ultimus
longe maximus, ambo ex axi superiorum deviantes, a t inter sese
paralleli; apertura pro anfractu ultimo verticalis, cireularis; peristoma
aurantium, rectum, obtusum, marginibus late disjunctis.
Long. 6, diam. maj. 3, min. 3; apert. \ \ Mill.
Molukken, Amboinagrwppe: Ceram, Wallace. Bei Amboina und
auf der Insel Buru bei Kajeli, am Boden feuchter Wälde r, von mir
gefunden.
Erinnert in der Form an manche Streptaxisarten.
Für die Gründe der Wiedervereinigung von Callia und Rhe-
gistoma mit Pupina kann ich auf Semper’s Bemerkungen im Journal
de conchyliologie 1865 p. 408—413 verweisen.
Dritte Unterfamilie C y c lo s tom e a .
Deckel mit wenig Windungen und excentrischem Kern.
Schale meist verlängert, ei- oder thurmförmig.
Die Färbung ist vorherrschend blassroth; wo Flecken Vorkommen,
sind es keine zickzackartige Striemen, wie bei Cyclotus
und Cyclophorus, sondern kleine gleichmässige rundliche in Spiralreihen;
die Epidermis löst sich nicht so leicht von der eigentlichen
Schale, wie bei jenen; Haare kommen meines Wissens nicht vor.
Die Sculptur ist oft sehr elegant gegittert. Ein doppelter Mundsaum
ist häufig wie bei den anderen Familien, besondere Rinnen und
Röhren an oder nahe demselben kommen nicht vor. Der Deckel
wechselt bei gleichem Bau und gleichem Schalenhabitus zwischen -
kalkig (z. B. Cyclostomus) und dünn, hornig (Cistula, Chondropoma),
analog wie bei Cyclotus und Cyclophorus.
Series secunda et tertia Pfr. men. p. 15.
Licinina und Cyclostomina Gray guide p. 82.
Cyclostominae und Pomatiasinae Adams gen. II. p. 290, 298.
Licinea, Cyclostomea, Cistulea, Pomatiatea und Realiea Pfr. mon.
suppl. p. 98; 109, 130, 149, 153.
Zweite Reihe der Cyclostomaceen Martens Mal. Bl. 1864 p. 132.
Diese Unterfamilie umfasst die Pfeiffer’sehen Gattungen Ja-
maicia, Licina, Choanopoma, Ctenopoma, Adamsiella, Lithidion,
Otopoma, Cyclostomus, Tudora, Leonia, Cistula und Chondropoma,
welche alle mir nahe mit einander verwandt scheinen. Sie sind die
einzigen Cyclostomaceen in Europa, Westasien und Afrika, die
vorherrschenden in Westindien und fehlen gänzlich in Ostasien und
den Inseln der Südsee.
Eine hauptsächlich im Gebiss abweichende Form bildet Po-
matias. Endlich liegt bis je tz t noch kein stichhaltiger Grund vor,
die Gattungen Realia und Omphalotropis aus dieser Unterfamilie
auszuschliessen, obwohl sie im Schalenhabitus sowohl als Vaterland
auffallend ab weichen. Nur letztere findet sich in unserem Gebiet.
O m p h a l o t r o p i s Pfr.
Deckel länglich, dünn, hornig mit wenig Windungen.
Schale durchbohrt oder eng genabelt, fast immer mit einem
Kiel um den Nabel, eiförmig bis gethürmt, nach oben zugespitzt;
Mündung eiförmig, M u n d s a um n i c h t z u s am m e n h ä n g e n d .
Pfr. Proc. z. s. 1851; mon. p. 306; Realia Gray guide p. 84;
Hydrocena (non Parreiss) Pfr. mon. Adams gen. II. p. 298 und Pfr.
mon. suppl. p. 155.
Als Typus der Gattung können die auch nach Weichtheilen
und Deckel bekannten Cyclostoma rubens und C. erosum von Quoy
und Gaimard dienen (vgl. Gray fig. moll. an. III. 311., 11. 12.).
Hiernach, besitzt das Thier sehr lange, dünne Fühler, eine zweilappige
Schnauze und einen flachen, länglichen Deckel ohne Fortsatz.
Man darf also unmöglich die dalmatische Hydrocena Parreiss damit
vereinigen, da diese äusserst kurze, kaum merkliche Fühler und
einen Fortsatz am Deckel, ähnlich dem der Neritinen h a t (Küster
Chemn. ed. nov. Gutt. Paludina 13., 32—35.). Realia wurde ursprünglich
von Gray 1840 für die neuseeländische R. Egea aufgestellt,
dann-1850 Arten der Gattungen Hydrocena und Omphalotropis
damit vereinigt; 1851 (Zeitschr. f. Malakoz. S. 175) beschränkte Pfeiffer
den Namen wieder auf R. Egea und schuf für die Mehrzahl der
anderen den neuen Namen Omphalotropis, behielt es auch so in