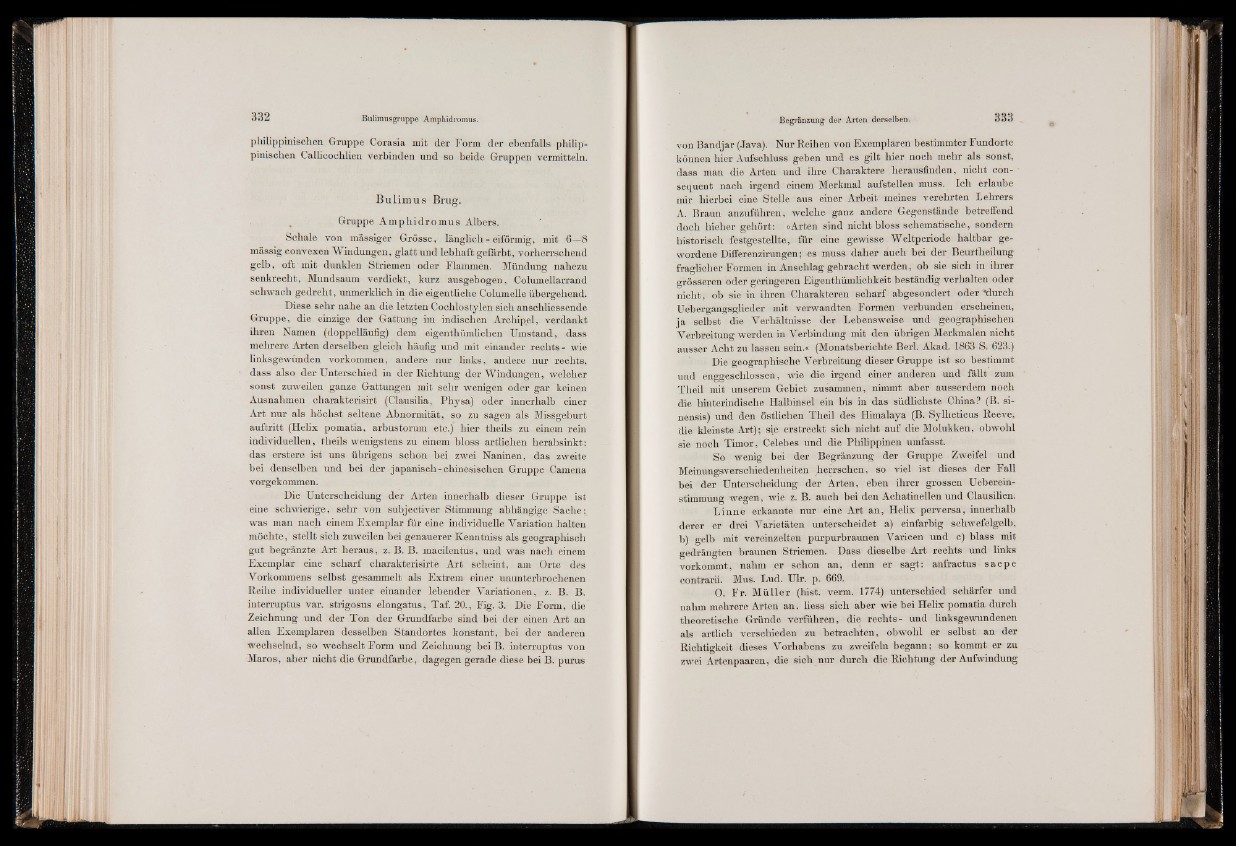
philippinischen Gruppe Corasia mit der Form der ebenfalls philippinischen
Callicochlien verbinden und so beide Gruppen vermitteln.
B u l im u s Brug.
Gruppe A m p h id rom u s Albers.
Schale von massiger Grösse, länglich - eiförmig, mit 6—8
massig convexen W indungen, glatt und lebhaft gefärbt , vorherrschend
gelb, oft mit dunklen Striemen oder Flammen. Mündung nahezu
senkrecht, Mundsaum verdickt, kurz ausgebogen, Columellarrand
schwach gedreht, unmerklich in die eigentliche Columelle übergehend.
Diese sehr nahe an die letzten Cochlostylen sich anschliessende
Gruppe, die einzige der Gattung im indischen Archipel, verdankt
ihren Namen (doppelläufig) dem eigenthümlichen Umstand, dass
mehrere Arten derselben gleich häufig und mit einander rech ts- wie
lmksgewunden Vorkommen, andere nur links, andere nur rechts,
dass also der Unterschied in der Richtung der Windungen, welcher
sonst zuweilen ganze Gattungen mit sehr wenigen oder gar keinen
Ausnahmen charakterisirt (Clausilia, Physa) oder innerhalb einer
Art nur als höchst seltene Abnormität, so zu sagen als Missgeburt
auftritt (Helix pomatia, arbustorum etc.) hier theils zu einem rein
individuellen, theils wenigstens zu einem bloss artlichen herabsinkt;
das erstere ist uns übrigens schon hei zwei Naninen, das zweite
bei denselben und bei der japanisch-chinesischen Gruppe Camena
vorgekommen.
Die Unterscheidung der Arten innerhalb dieser Gruppe ist
eine schwierige, sehr von subjectiver Stimmung abhängige Sache;
was man nach einem Exemplar für eine individuelle Variation halten
möchte, stellt sich zuweilen bei genauerer Kenntniss als geographisch
gut begränzte Art heraus, z. B. B. macilentus, und was nach einem
Exemplar eine scharf charakterisirte Art scheint, am Orte des
Vorkommens selbst gesammelt als Extrem einer ununterbrochenen
Reihe individueller unter einander lebender Variationen, z. B. B.
interruptus var. strigosus elongatus, Taf. 20., Fig. 3. Die Form, die
Zeichnung und der Ton der Grundfarbe sind bei der einen Art an
allen Exemplaren desselben Standortes konstant, bei der anderen
wechselnd, so wechselt Form und Zeichnung bei B. interruptus von
Maros, aber nicht die Grundfarbe, dagegen gerade diese bei B. purus
von Bandjar (Java). Nur Reihen von Exemplaren bestimmter Fundorte
können hier Aufschluss geben und es gilt hier noch mehr als sonst,
dass man die Arten und ihre Charaktere herausfinden, nicht eon-
sequent nach irgend ' einem Merkmal aufstellen muss. Ich erlaube
mir hierbei eine Stelle aus einer Arbeit meines verehrten Lehrers
A. Braun anzuführen, welche ganz andere Gegenstände betreifend
doch hieher gehört: »Arten sind nicht bloss schematische, sondern
historisch festgestellte, für eine gewisse Weltperiode haltbar gewordene
Diflerenzirungen; es muss daher auch bei der Beurtheilung
fraglich er Formen in Anschlag gebracht werden, ob sie sich in ihrer
grösseren oder geringeren Eigenthümlichkeit beständig verhalten oder
nicht, ob sie in ihren Charakteren scharf abgesondert oder *durch
Uebergangsglieder mit verwandten Formen verbunden erscheinen,
ja selbst die Verhältnisse der Lebensweise und geographischen
Verbreitung werden in Verbindung mit den übrigen Merkmalen nicht
ausser Acht zu lassen sein.« (Monatsberichte Berl. Akad. 1863 S. 623.)
Die geographische Verbreitung dieser Gruppe ist so bestimmt
und enggeschlossen, wie die irgend einer anderen und fällt zum
Theil mit unserem Gebiet zusammen, nimmt aber ausserdem noch
die hinterindische Halbinsel ein bis in das südlichste China? (B. sinensis)
und den östlichen Theil des Himalaya (B. Sylheticus Reeve,
die kleinste Art); sie erstreckt sich nicht auf die Molukken, obwohl
sie noch Timor, Celebes und die Philippinen umfasst.
So wenig bei der Begränzung der Gruppe Zweifel und
Meinungsverschiedenheiten herrschen, so viel ist dieses der Fall
bei der Unterscheidung der Arten, eben ihrer grossen Ueberein-
stimmung wegen, wie z. B. auch bei den Achatinellen und Clausilien.
L in n e erkannte nur eine Art an, Helix perversa, innerhalb
derer er drei Varietäten unterscheidet a) einfarbig schwefelgelb,
b) gelb mit vereinzelten purpurbraunen Varicen und c) blass mit
gedrängten braunen Striemen. Dass dieselbe Art rechts und links
vorkommt, nahm er schon an, denn er sagt: anffaetus s a e p e
contrarii. Mus. Lud. Ulr. p. 669.
O. F r. M ü l le r (hist. verm. 1774) unterschied schärfer und
nahm mehrere Arten an, liess sich aber wie bei Helix pomatia durch
theoretische Gründe verführen, die re ch ts- und linksgewundenen
als artlich verschieden zu betrachten, obwohl er selbst an der
Richtigkeit dieses Vorhabens zu zweifeln begann; so kommt er zu
zwei Artenpaaren, die sich nur durch die Richtung der Aufwindung