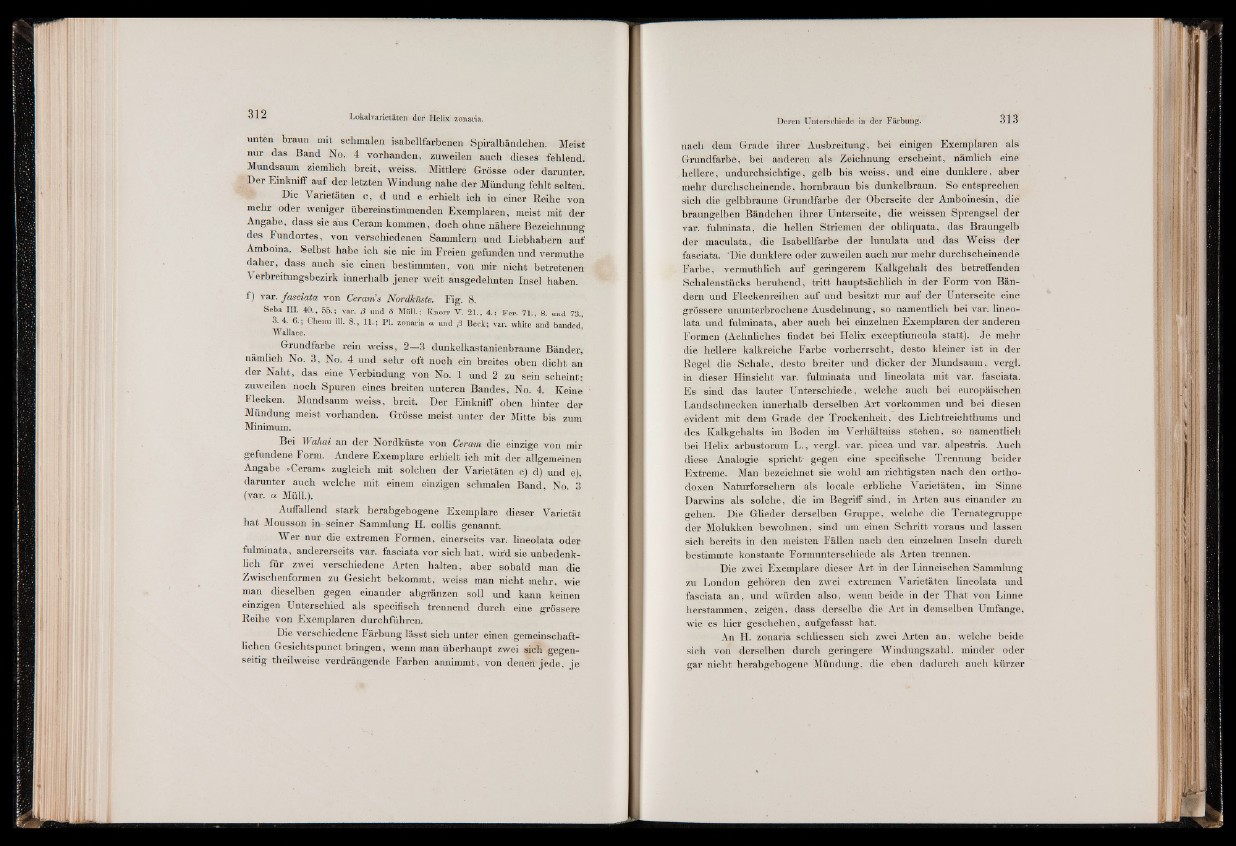
unten braun mit schmalen isabellfarbenen Spiralbändehen. Meist
nur das Band No. 4 vorhanden, zuweilen auch dieses fehlend.
Mundsaum ziemlich breit, weiss. Mittlere Grösse oder darunter.
gDer Einkniff auf der letzten Windung nahe der Mündung fehlt selten.
9< Die Varietäten c, d und e erhielt ich in einer Reihe von
mehr oder weniger übereinstimmenden Exemplaren, meist mit der
Angabe, dass sie aus Ceram kommen, doch ohne nähere Bezeichnung
des Fundortes, von verschiedenen Sammlern und Liebhabern auf
Amboina. Selbst habe ich sie nie im Freien gefunden und vermuthe
daher, dass auch sie einen bestimmten, von mir nicht betretenen
Verbreitungsbezirk innerhalb jen e r weit ausgedehnten Insel haben.
i) var. fasciata von Ceranis Nordküste. Fig. 8.
Seba III. 40., 55.; var. ß und ö Müll.; Knorr Y. 21., 4.; Fer. 71., 8. und 73.,
3. 4. 6.; Chenu ill. 8., 11.; PI. zonaria a und ß Beck; var. white and banded,
Wallace.
Grundfarbe rein weiss, 2—3 dunkelkastanienbraune Bänder,
nämlich No. 3, No. 4 und sehr oft noch ein breites oben dicht an
der Naht, das eine Verbindung von No. 1 und 2 zu sein scheint;
zuweilen noch Spuren eines breiten unteren Bandes, No. 4. Keine
Flecken. Mundsaum weiss, breit. Der Einkniff oben hinter der
Mündung meist vorhanden. Grösse meist unter der Mitte bis zum
Minimum.
Bei Wahai an der Nordküste von Ceram die einzige von mir
gefundene Form. Andere Exemplare erhielt ich mit der allgemeinen
Angabe »Ceram« zugleich mit solchen der Varietäten c) d) und e),
darunter auch welche mit einem einzigen schmalen Band, No. 3
(var. ex Müll.).
Auffallend stark herabgebogene Exemplare dieser Varietät
h a t Mousson in seiner Sammlung H. collis genannt.
Wer nur die extremen Formen, einerseits var. lineolata oder
fulmmata, andererseits var. fasciata vor sich h a t, wird sie unbedenklich
für zwei verschiedene Arten halten, aber sobald man die
Zwischenformen zu Gesicht bekommt, weiss man nicht mehr, wie
man dieselben gegen einander abgränzen soll und kann keinen
einzigen Unterschied als specifisch trennend durch eine grössere
Reihe von Exemplaren durchführen.
Die verschiedene Färbung lässt sich unter einen gemeinschaftlichen
Gesichtspunct bringen, wenn man überhaupt zwei sich gegenseitig
theilweise verdrängende Farben annimmt, von denen jed e , je
nach dem Grade ihrer Ausbreitung, bei einigen Exemplaren als
Grundfarbe, bei anderen als Zeichnung erscheint, nämlich eine
hellere, undurchsichtige, gelb bis weiss, und eine dunklere, aber
mehr durchscheinende, hornbraun bis dunkelbraun. So entsprechen
sich die gelbbraune Grundfarbe der Oberseite der Amboinesin, die
braungelben Bändchen ihrer Unterseite, die weissen Sprengsel der
var. fulminata, die hellen Striemen der obliquata, das Braungelb
der maculata, die Isabellfarbe der lunulata und das Weiss der
fasciata. 'Die dunklere oder zuweilen auch nur mehr durchscheinende
Farbe, vermuthlich auf geringerem Kalkgehalt des betreffenden
Schalenstücks beruhend, tritt hauptsächhch in der Form von Bändern
und Fleckenreihen auf und besitzt nur auf der Unterseite eine
grössere ununterbrochene Ausdehnung, so namentlich bei var. lineolata
und fulminata, aber auch bei einzelnen Exemplaren der anderen
Formen (Aehnhches findet bei Helix exceptiuncula statt). Je mehr
die hellere kalkreiche Farbe vorherrscht, desto kleiner ist in der
Regel die Schale, desto breiter und dicker der Mundsaum, vergl.
in dieser Hinsicht var. fulminata und hneolata mit var. fasciata.
Es sind das lauter Unterschiede, welche auch bei europäischen
Landschnecken innerhalb derselben Art Vorkommen und bei diesen
evident mit dem Grade der Trockenheit, des Lichtreichthums und
des Kalkgehalts im Boden im Verhältniss stehen, so namentlich
bei Helix arbustorum L ., vergl. var. picea und var. alpestris. Auch
diese Analogie spricht' gegen eine specifische Trennung beider
Extreme. Man bezeichnet sie wohl am richtigsten nach den orthodoxen
Naturforschern als locale erbliche Varietäten, im Sinne
Darwins als solche, die im Begriff sind, in Arten aus einander zu
gehen. Die Glieder derselben Gruppe,. welche die Temategruppe
der Molukken bewohnen, sind um einen Schritt voraus und lassen
sich bereits in den meisten Fällen nach den einzelnen Inseln durch
bestimmte konstante Formunterschiede als Arten trennen.
Die zwei Exemplare dieser Art in der Linneischen Sammlung
zu London gehören den zwei extremen Varietäten lineolata und
fasciata an, und würden also, wenn beide in der T h a t von Linne
herstammen, zeigen, dass derselbe die Art in demselben Umfange,
wie es hieT geschehen, aufgefasst hat.
An H. zonaria schliessen sich zwei Arten an, welche beide
sich von derselben durch geringere Windungszahl, minder oder
gar nicht herabgebogene Mündung, die eben dadurch auch kürzer