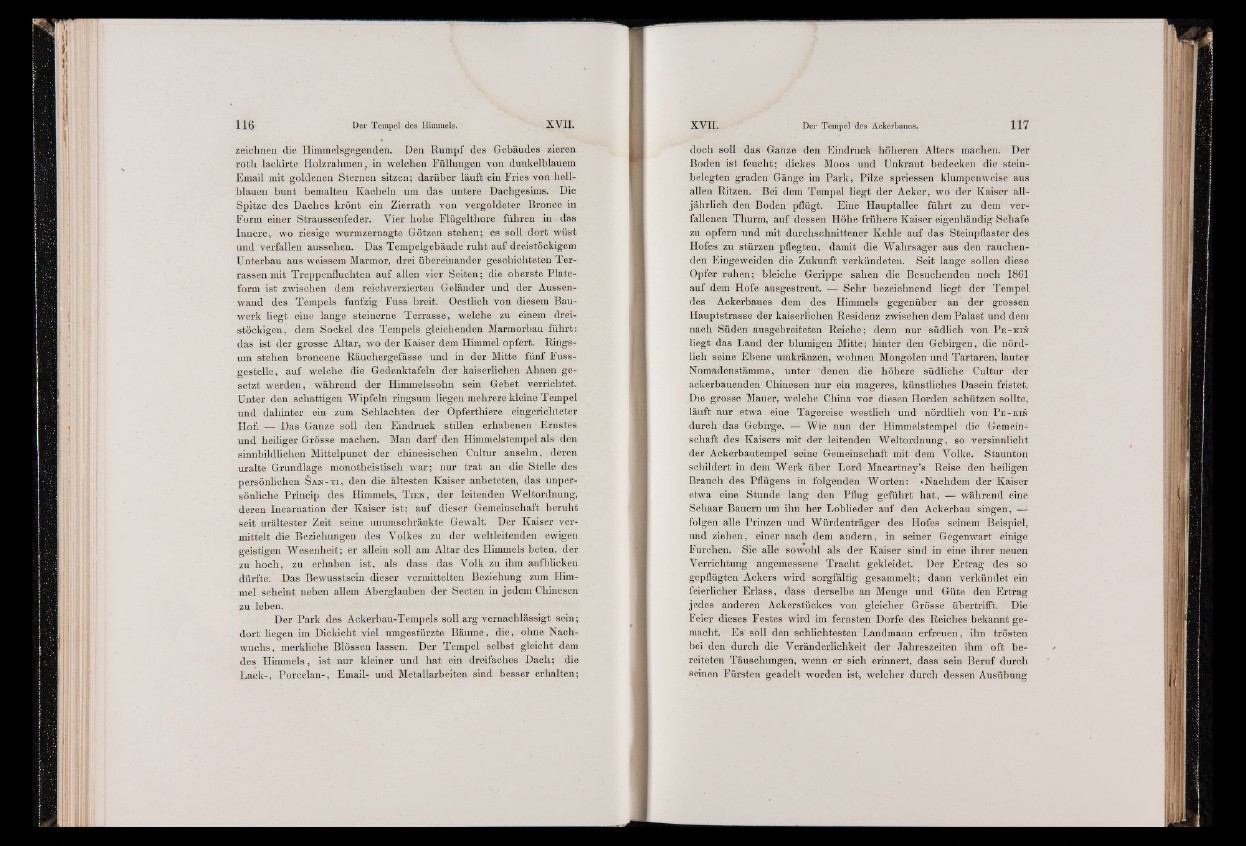
zeichnen die Himmelsgegenden. Den Rumpf des Gebäudes zieren
ro th lackirte Holzrahmen, in welchen Füllungen von dunkelblauem
Email mit goldenen Sternen sitzen; darüber läuft ein Fries von hellblauen
bunt bemalten Kacheln um das untere Dachgesims. Die
Spitze des Daches krönt ein Zierrath von vergoldeter Bronce in
Form einer Straussenfeder. Vier hohe Flügeltliore führen in das
Innere, wo riesige wurmzernagte Götzen stehen; es soll dort wüst
und verfallen aussehen. Das Tempelgebäude ru h t auf dreistöckigem
Unterbau aus weissem Marmor, drei übereinander geschichteten Terrassen
mit Treppenfluchten auf allen vier Seiten; die oberste Plateform
ist zwischen dem reichverzierten Geländer und der Aussen-
wand des Tempels fünfzig Fuss breit. Oestlich von diesem Bauwerk
liegt eine lange steinerne Terrasse, welche zu einem dreistöckigen,
dem Sockel des Tempels gleichenden Marmorbau führt:
das ist der grosse Altar, wo der Kaiser dem Himmel opfert. Ringsum
stehen broncene Räuchergefässe und in der Mitte fünf Fuss-
gestelle, auf welche die Gedenktafeln der kaiserlichen Ahnen gesetzt
werden, während der Himmelssohn sein Gebet verrichtet.
Unter den schattigen Wipfeln ringsum liegen mehrere kleine Tempel
und dahinter ein zum Schlachten der Opferthiere eingerichteter
Hof. — Das Ganze soll den Eindruck stillen erhabenen Ernstes
und heiliger Grösse machen. Man darf den Himmelstempel als den
sinnbildlichen Mittelpunct der chinesischen Cultur ansehn, deren
uralte Grundlage monotheistisch war; nur tra t an die Stelle des
persönlichen San- t i , den die ältesten Kaiser anbeteten, das unpersönliche
Princip des Himmels, T ien, der leitenden Weltordnung,
deren Incarnation der Kaiser ist; auf dieser Gemeinschaft beruht
seit urältester Zeit seine unumschränkte Gewalt. Der Kaiser vermittelt
die Beziehungen des Volkes zu der weltleitenden ewigen
geistigen Wesenheit; er allein soll am Altar des Himmels beten, der
zu hoch, zu erhaben ist, als dass das Volk zu ihm aufblicken
dürfte. Das Bewusstsein dieser vermittelten Beziehung zum Himmel
scheint neben allem Aberglauben der Secten in jedem Chinesen
zu leben.
Der Park des Ackerbau-Tempels soll arg vernachlässigt sein;
dort liegen im Dickicht viel umgestürzte Bäume, die, ohne Nachwuchs,
merkliche Blössen lassen. Der Tempel selbst gleicht dem
des Himmels, ist nur kleiner und h a t ein dreifaches Dach; die
Lack-, Porcelan-, Email- und Metallarbeiten sind besser erhalten;
doch soll das Ganze den Eindruck höheren Alters machen. Der
Boden ist feucht; dickes Moos und Unkraut bedecken die steinbelegten
graden Gänge im P a rk , Pilze spriessen klumpenweise aus
allen Ritzen. Bei dem Tempel liegt der Acker, wo der Kaiser alljährlich
den Boden pflügt. Eine Hauptallee führt zu dem verfallenen
Thurm, auf dessen Höhe frühere Kaiser eigenhändig Schafe
zu opfern und mit durchschnittener Kehle auf das Steinpflaster des
Hofes zu stürzen pflegten, damit die Wahrsager aus den rauchenden
Eingeweiden die Zukunft verkündeten. Seit lange sollen diese
Opfer ruhen; bleiche Gerippe sahen die Besuchenden noch 1861
auf dem Hofe ausgestreut. — Sehr bezeichnend liegt der Tempel
des Ackerbaues dem des Himmels gegenüber an der grossen
Hauptstrasse der kaiserlichen Residenz zwischen dem Palast und dem
nach Süden ausgebreiteten Reiche; denn nur südlich von P e - k in
liegt das Land der blumigen Mitte; hinter den Gebirgen, die nördlich
seine Ebene umkränzen, wohnen Mongolen und Tartaren, lauter
Nomadenstämme, unter denen die höhere südliche Cultur der
ackerbauenden Chinesen nur ein mageres, künstliches Dasein fristet.
Die grosse Mauer, welche China vor diesen Horden schützen sollte,
läuft nur etwa eine Tagereise westlich und nördlich von P e - k in
durch das Gebirge. — Wie nun der Himmelstempel die Gemeinschaft
des Kaisers mit der leitenden Weltordnung, so versinnlicht
der Ackerbautempel seine Gemeinschaft mit dem Volke. Staunton
schildert in dem Werk über Lord Macartney’s Reise den heiligen
Brauch des Pflügens in folgenden Worten: »Nachdem der Kaiser
etwa eine Stunde lang den Pflug geführt h a t, — während eine
Schaar Bauern um ihn h er Loblieder auf den Ackerbau singen, —
folgen alle Prinzen und Würdenträger des Hofes seinem Beispiel,
und ziehen, einer nach dem ändern, in seiner Gegenwart einige
Furchen. Sie alle sowohl als der Kaiser sind in eine ihrer neuen
Verrichtung angemessene Tracht gekleidet. Der Ertrag des so
gepflügten Ackers wird sorgfältig gesammelt; dann verkündet ein
feierlicher Erlass, dass derselbe an Menge und Güte den Ertrag
jedes anderen Ackerstückes von gleicher Grösse übertrifft. Die
Feier dieses Festes wird im fernsten Dorfe des Reiches bekannt gemacht.
Es' soll den schlichtesten Landmann erfreuen, ihn trösten
bei den durch die Veränderlichkeit der Jahreszeiten ihm oft bereiteten
Täuschungen, wenn er sich erinnert, dass sein Beruf durch
seinen Fürsten geadelt worden ist, welcher durch dessen Ausübung