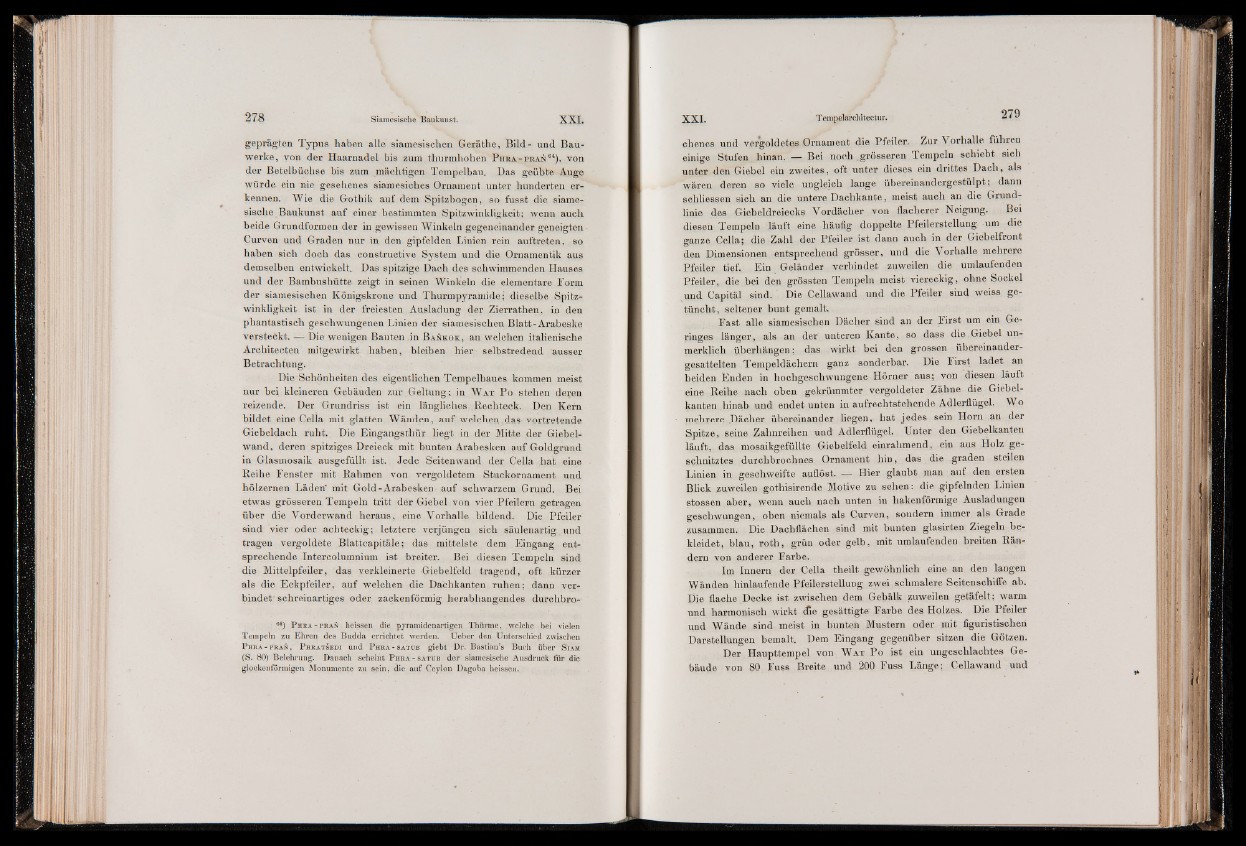
geprägten Typus haben alle siamesischen Geräthe, Bild- und Bauwerke,
von der Haarnadel bis zum thurmhohen P h r a - p r a n 64), von
der Betelbüchse bis zum mächtigen Tempelbau. Das geübte Auge
würde ein nie gesehenes siamesiches Ornament unter hunderten erkennen.
Wie die Gothik auf dem Spitzbogen, so fusst die siamesische
Baukunst auf einer bestimmten Spitzwinkligkeit; wenn auch
beide Grundformen der in gewissen Winkeln gegeneinander geneigten
Curven und Graden nur in den gipfelden Linien rein auftreten, so
haben sich doch das constructive System und die Ornamentik aus
demselben entwickelt. Das spitzige Dach des schwimmenden Hauses
und der Bambushütte zeigt in seinen Winkeln die elementare Form
der siamesischen Königskrone und Thurmpyramide; dieselbe Spitzwinkligkeit
ist in der freiesten Ausladung der Zierrathen, in den
phantastisch geschwungenen Linien der siamesischen Blatt-Arabeske
versteckt. — Die wenigen Bauten in B a n k o k , an welchen italienische
Architecten mitgewirkt haben, bleiben hier selbstredend ausser
Betrachtung.
Die Schönheiten des eigentlichen Tempelbaues kommen meist
nur hei kleineren Gebäuden zur.Geltung: in W at P o stehen deren
reizende. Der Grundriss ist ein längliches Rechteck. Den Kern
bildet eine Cella mit glatten Wänden, auf welchen .das vortretende
Giebeldach ruht. Die Eingangsthür liegt in der Mitte der Giebelwand,
deren spitziges Dreieck mit bunten Arabesken auf Goldgrund
in Glasmosaik ausgefüllt ist. Jede Seitenwand der Cella h a t eine
Reihe Fenster mit Rahmen von vergoldetem Stuckornament und
hölzernen Läden" mit Gold-Arabesken auf schwarzem Grund. Bei
etwas grösseren Tempeln tritt der Giebel von vier Pfeilern getragen
über die Vorderwand heraus, eine Vorhalle bildend. Die Pfeiler
sind vier oder achteckig; letztere verjüngen sich säulenartig und
tragen vergoldete Blattcapitäle; das mittelste dem Eingang entsprechende
Intereolumnium ist breiter. Bei diesen Tempeln sind
die Mittelpfeiler, das verkleinerte Giebelfeld tragend, oft kürzer
als die Eckpfeiler, auf welchen die Dachkanten ruhen; dann verbindet
schreinartiges oder zackenförmig herabhangendes durchbro-
P h r a - p r a n heissen die pyramidenartigen Thürme, welche bei vielen
Tempeln zu Ehren des Budda errichtet werden. Ueber den Unterschied zwischen
P h r a - p r a n , P h r a t s e d i und P h r a - s a t u b giebt Dr. Bästian’s Buch über S ia m
( S . 80) Belehrung. Danach scheint P h r a - s a t u b der siamesische Ausdruck für die
glockenförmigen Monumente zu sein, die auf Ceylon Dagoba heissen.
ebenes und vergoldetes Ornament die Pfeiler. Zur Vorhalle führen
einige Stufen hinan. — Bei noch . grösseren Tempeln schiebt sich
unter den Giebel ein zweites, oft unter dieses ein drittes Dach, als
wären deren so viele ungleich lange übereinandergestülpt; dann
schliessen sich an die untere Dachkante, meist auch an die Grundlinie
des Giebeldreiecks Vordächer von flacherer Neigung. Bei
diesen Tempeln läuft eine häufig doppelte Pfeilerstellung um die
ganze Cella; die Zahl der Pfeiler ist dann auch in der Giebelfront
den Dimensionen entsprechend grösser, und die \o rh a lle mehrere
Pfeiler tief. Ein Geländer verbindet zuweilen die umlaufenden
Pfeiler, die bei den grössten Tempeln meist viereckig, ohne Sockel
und Capitäl sind. Die Cellawand und die Pfeiler sind weiss getüncht,
seltener bunt gemalt.
Fast, alle siamesischen Dächer sind an der b irs t um ein Geringes
länger, als an der unteren Kante, so dass die.Giebel unmerklich
Überhängen; das wirkt bei den grossen übereinandergesattelten
Tempeldächern ganz sonderbar. Die b irst ladet an
beiden Enden in hochgeschwungene Hörner aus; von diesen läuft
eine Reihe nach oben gekrümmter vergoldeter Zähne die Giebelkanten
hinab und endet unten in aufrechtstehende Adlerflügel. Wo
mehrere Dächer übereinander liegen, hat jedes sein Horn an der
Spitze, seine Zahnreihen und Adlerflügel. Unter den Giebelkanten
läuft, das mosaikgefüllte Giebelfeld einrahmend, ein aus Holz geschnitztes
durchbrochnes Ornament hin, das die graden steilen
Linien in geschweifte auflöst. — Hier glaubt man auf den ersten
Blick zuweilen gothisirende Motive zu sehen: die gipfelnden Linien
stossen aber, wenn auch nach unten in hakenförmige Ausladungen
geschwungen, oben niemals als Curven, sondern immer als Grade
zusammen. Die Dachflächen sind mit bunten glasirten Ziegeln bekleidet,
blau, ro th , grün oder gelb, mit umlaufenden breiten Rändern
von anderer Farbe.
Im Innern der Cella theilt gewöhnlich eine an den langen
Wänden hinlaufende Pfeilerstellung zwei schmalere Seitenschiffe ab.
Die flache Decke ist zwischen dem Gebälk zuweilen getäfelt; warm
und harmonisch wirkt cfie gesättigte Farbe des Holzes. Die Pfeiler
und Wände sind meist in bunten Mustern oder mit figuristischen
Darstellungen bemalt. Dem Eingang gegenüber sitzen die Götzen.
Der Haupttempel von W at P o ist ein ungeschlachtes Gebäude
von 80 Fuss Breite und 200 Fuss Länge; Cellawand und