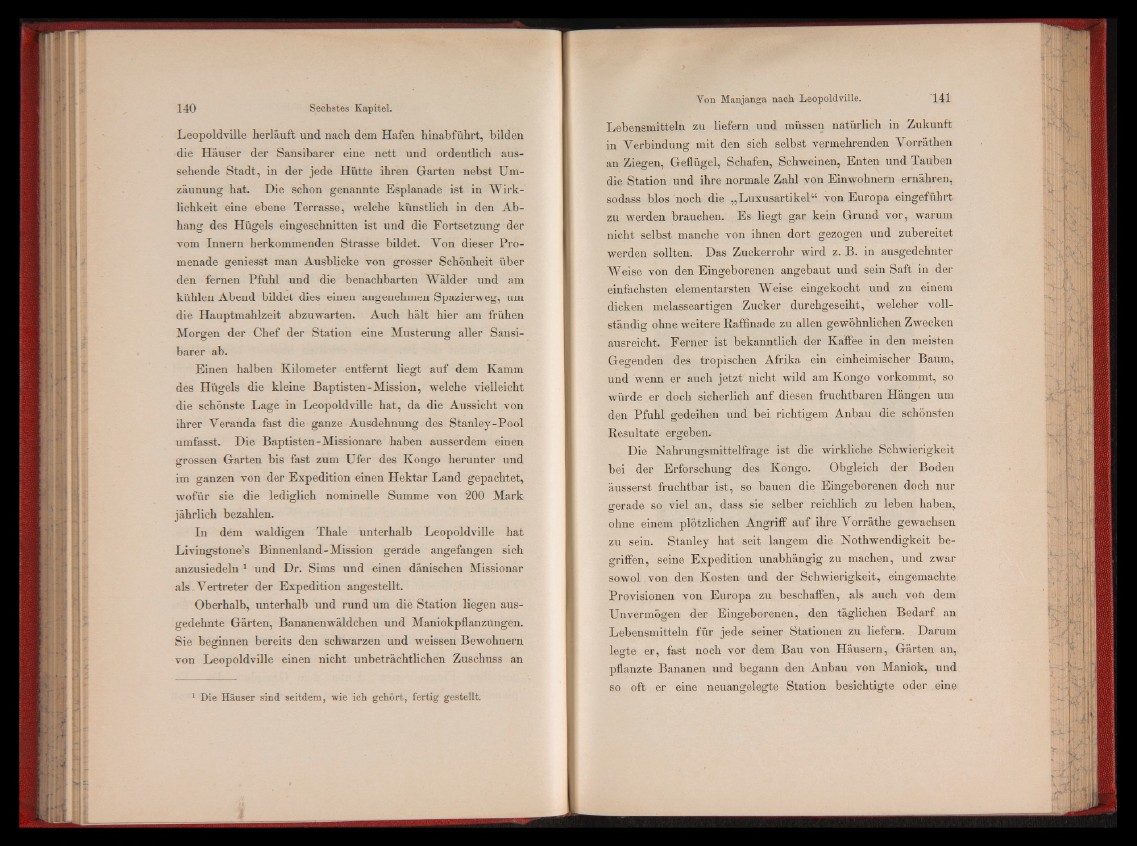
Leopoldville herläuft und nach dem Hafen hinabführt, bilden
die Häuser der Sansibarer eine nett und ordentlich aussehende
Stadt, in der jede Hütte ihren Garten nebst Umzäunung
hat. Die schon genannte Esplanade ist in W irk lichkeit
eine ebene Terrasse, welche künstlich in den Abhang
des Hügels eingeschnitten ist und O o ö die FortsetzunOg der
vom Innern herkommenden Strasse bildet. Von dieser Promenade
geniesst man Ausblicke von grösser Schönheit über
den fernen Pfuhl und die benachbarten Wälder und am
kühlen Abend bildet dies einen angenehmen Spazierweg, um
die Hauptmahlzeit abzuwarten. Auch hält hier am frühen
Morgen der Chef der Station eine Musterung aller Sansibarer
ab.
Einen halben Kilometer entfernt liegt auf dem Kamm
des Hügels die kleine Baptisten-Mission, welche vielleicht
die schönste Lage in Leopoldville h at, da die Aussicht von
ihrer Veranda fast die ganze Ausdehnung des Stanley-Pool
umfasst. Die Baptisten-Missionare haben ausserdem einen
ög rossen Garten bis fast zum Ufer des Kongo o herunter und
im ganzen von der Expedition einen Hektar Land gepachtet,
wofür sie die lediglich nominelle Summe von 200 Mark
jährlich bezahlen.
In dem waldigen Thale unterhalb Leopoldville hat
Livingstone’s Binnenland-Mission gerade angefangen sich
anzusiedeln 1 und Dr. Sims und einen dänischen Missionar
als Vertreter der Expedition angestellt.
Oberhalb, unterhalb und rund um die Station liegen ausgedehnte
Gärten, Bananenwäldchen und ManiokpflanzUngen.
Sie beginnen bereits den schwarzen und weissen Bewohnern
von Leopoldville einen nicht unbeträchtlichen Zuschuss an
1 Die Häuser sind seitdem, wie ich gehört, fertig gestellt.
Lebensmitteln zu liefern und müssen natürlich in Zukunft
in Verbindung mit den sich selbst vermehrenden Vorräthen
an Ziegen, Geflügel, Schafen, Schweinen, Enten und Tauben
die Station und ihre normale Zahl von Einwohnern ernähren,
sodass blos noch die „Luxusartikel“ von Europa eingeführt
zu werden brauchen. Es liegt gar kein Grund vor, warum
nicht selbst manche von ihnen dort gezogen und zubereitet
werden sollten. Das Zuckerrohr wird z. B. in ausgedehnter
Weise von den Eingeborenen angebaut und sein Saft in der
einfachsten elementarsten Weise eingekocht und zu einem
dicken melasseartigen Zucker durchgeseiht, welcher vollständig
ohne weitere Raffinade zu allen gewöhnlichen Zwecken
ausreicht. Ferner ist bekanntlich der Kaffee in den meisten
Gegenden des tropischen Afrika ein einheimischer Baum,
und wenn er auch jetzt nicht wild am Kongo vorkommt, so
würde er doch sicherlich auf diesen fruchtbaren Hängen um
den Pfuhl gedeihen und bei richtigem Anbau die schönsten
Resultate ergeben.
Die Nahrungsmittelfrage ist die wirkliche Schwierigkeit
bei der Erforschung des Kongo. Obgleich der Boden
äusserst fruchtbar ist, so bauen die Eingeborenen doch nur
gerade so viel an, dass sie selber reichlich zu leben haben,
ohne einem plötzlichen Angriff auf ihre Vorräthe gewachsen
zu sein. Stanley hat seit langem die Nothwendigkeit begriffen,
seine Expedition unabhängig zu machen, und zwar
sowol von den Kosten und der Schwierigkeit, eingemachte
Provisionen von Europa zu beschaffen, als auch von dem
Unvermögen der Eingeborenen, den täglichen Bedarf an
Lebensmitteln fü r jede seiner Stationen zu liefern. Darum
legte er, fast noch vor dem Bau von Häusern, Gärten an,
pflanzte Bananen und begann den Anbau von Maniok, und
so oft er eine neuangelegte Station besichtigte oder eine