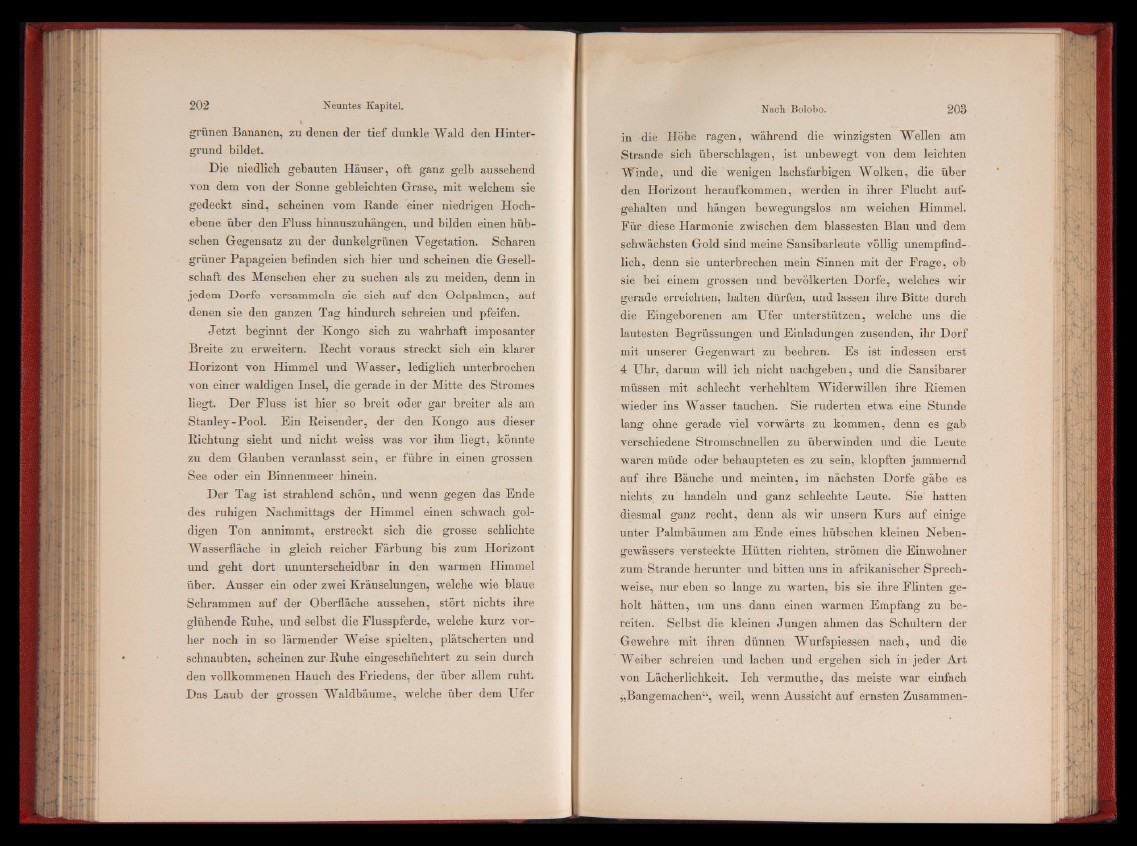
grünen Bananen, zu denen der tie f dunkle Wald den Hintergrund
bildet.
Die niedlich gebauten Häuser, oft ganz gelb aussehend
von dem von der Sonne gebleichten Grase, mit welchem sie
gedeckt sind, scheinen vom Bande einer niedrigen Hochebene
über den Fluss hinauszuhängen, und bilden einen hübschen
Gegensatz zu der dunkelgrünen Vegetation. Scharen
grüner Papageien befinden sich hier und scheinen die Gesellschaft
des Menschen eher zu suchen als zu meiden, denn in
jedem Dorfe versammeln sie sich auf den Oelpalmen, auf
denen sie den ganzen Tag hindurch schreien und pfeifen.
J e tz t beginnt der Kongo sich zu wahrhaft imposanter
Breite zu erweitern. Becht voraus streckt sich ein klarer
Horizont von Himmel und Wasser, lediglich unterbrochen
von einer waldigen Insel, die gerade in der Mitte des Stromes
liegt. Der Fluss ist hier so breit oder O Ogar breiter als am
Stanley-Pool. Ein Beisender, der den Kongo aus dieser
Bichtung sieht und nicht weiss was vor ihm liegt, könnte
zu dem Glauben veranlasst sein, er führe in einen grossen
See oder ein Binnenmeer hinein.
Der Tag ist strahlend schön, und wenn gegen das Ende
des ruhigen Nachmittags der Himmel einen schwach goldigen
Ton annimmt, erstreckt sich die grosse schlichte
Wasserfläche in gleich reicher Färbung bis zum Horizont
und geht dort ununterscheidbar in den warmen Himmel
über. Ausser ein oder zwei Kräuselungen, welche wie blaue
Schrammen auf der Oberfläche aussehen, stört nichts ihre
glühende Buhe, und selbst die Flusspferde, welche kurz vorher
noch in so lärmender Weise spielten, plätscherten und
schnaubten, scheinen zur Buhe eingeschüchtert zu sein durch
den vollkommenen Hauch des Friedens, der über allem ruht.-
Das Laub der grossen Waldbäume, welche über dem Ufer
in die Höhe ragen,- während die winzigsten Wellen am
Strande sich überschlagen, ist unbewegt von dem leichten
Winde, und die wenigen lachsfarbigen Wolken, die über
den Horizont heraufkommen, werden in ihrer Flucht au fgehalten
und hängen bewegungslos am weichen Himmel.
F ü r diese Harmonie zwischen dem blässesten Blau und dem
schwächsten Gold sind meine Sansibarleute völlig unempfindlich,
denn sie unterbrechen mein Sinnen mit der Frage, ob
sie bei einem grossen und bevölkerten Dorfe, welches wir
gerade erreichten, halten dürfen, und lassen ihre Bitte durch
die Eingeborenen am Ufer unterstützen, welche uns die
lautesten Begrüssungen und Einladungen zusenden, ihr Dorf
mit unserer Gegenwart zu beehren. Es ist indessen erst
4 Uhr, darum will ich nicht nachgeben, und die Sansibarer
müssen mit schlecht verhehltem Widerwillen ihre Biemen
wieder ins Wasser tauchen. Sie ruderten etwa eine Stunde
lang ohne gerade viel vorwärts zu kommen, denn es gab
verschiedene Stromschnellen zu überwinden und die Leute
waren müde oder behaupteten es zu sein, klopften jammernd
auf ihre Bäuche und meinten, im nächsten Dorfe gäbe es
nichts_ zu handeln und ganz schlechte Leute. Sie' hatten
diesmal ganz recht, denn als wir unsern Kurs auf einige
unter Palmbäumen am Ende eines hübschen kleinen Nebengewässers
versteckte Hütten richten, strömen die Einwohner
zum Strande herunter und bitten uns in afrikanischer Sprechweise,
nur eben so lange zu warten, bis sie ihre Flinten geholt
hätten, um uns dann einen warmen Empfang zu bereiten.
Selbst die kleinen Jungen ahmen das Schultern der
Gewehre mit ihren dünnen Wurfspiessen nach, und die
Weiber schreien und lachen und ergehen sich in jeder Art
von Lächerlichkeit. Ich vermuthe, das meiste war einfach
j,Bangemachen“, weil, wenn Aussicht auf ernsten Zusammen