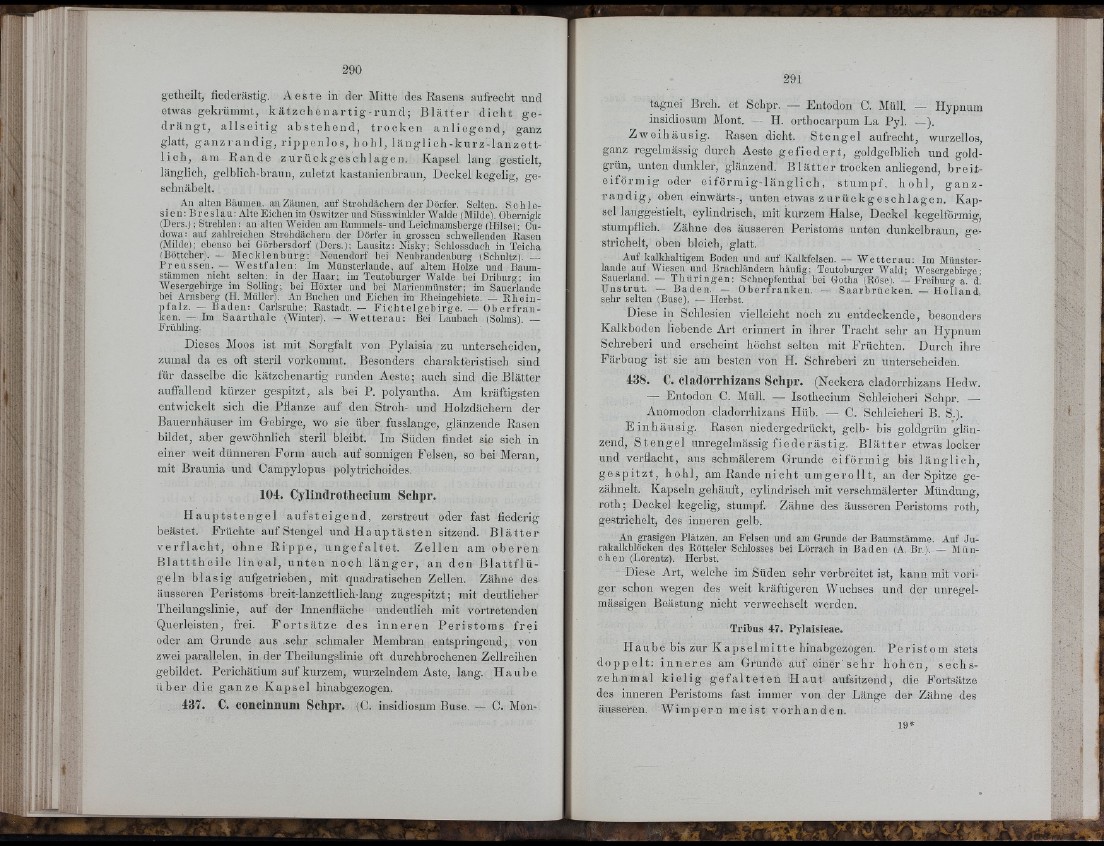
V II
getheilt, tiederästig. A e s te in der Mitte des Rasens aufrecht und
etwas gekrümmt, k ä t z c h e n a r t i g - r u n d ; B l ä t t e r d ich t g e d
r ä n g t , a l l s e i t ig a b s te h e n d , t ro c k e n a n l ie g e n d , ganz
glatt, g a n z r a n d ig , r ip p e n io s , hohl, l ä n g l ic h -k u r z - la n z e t t -
l ic h , am Ra n d e z u r ü c k g e s c h la g e n . Kapsel lang gestielt,
länglich, gelblich-braun, zuletzt kastanienbraun, Deckel kegelig, geschnäbelt.
An alten Bäumen, an Zäunen, auf Strolidäcliern der Dörfer. Selten. S c h l e s
ie n : B r e s la u : Alte Eichen im Oswitzer und Süsswinkler Walde (Milde). Obernigk
(Ders.); Strehlen; an alten Weiden am Rummels- und Leichnamsberge (Hilse); Cudowa:
auf zahlreichen Strohdäcliern der Dörfer in grossen schwellenden Rasen
(Milde); ebenso bei Görbersdorf (Ders.); Lausitz: Nisky; Schlossdach in Teicha
(Böttcher). — M e c k l e n b u r g : Neuendorf bei Neubrandenburg (Schultz), —
P r e u s s e n . — W e s t f a l e n : Im Münsterlande, auf altem Holze und Baumstämmen
nicht selten; in der Haar; im Teutoburger Walde bei Driburg; im
Wesergebirge im Solling; bei Höxter und bei Marienmüuster; im Sauerlande
bei Arnsberg (H. Müller). An Euchen und Eichen im Rheingebiete. — R h e in p
f a l z . — B a d e n : Carlsruhe; Rastadt. — F i c h t e l g e b i r g e . — O b e r f r a n k
en . — Im S a a r th a l e (Winter). — W e t t e r a u : Bei Laubach (Solms). —
Frühling.
Dieses Moos ist mit Sorgfalt von Pylaisia zu unterscheiden,
zumal da es oft steril vorkommt. Besonders charakteristisch sind
für dasselbe die kätzchenartig runden Aeste; auch sind die Blätter
auffallend kürzer gespitzt, als bei P. polyantha. Am kräftigsten
entwickelt sich die Pflanze auf den Stroh- und Holzdächern der
Bauernhäuser im Gebirge, wo sie über fusslange, glänzende Rasen
bildet, aber gewöhnlich steril bleibt. Im Süden flndet sie sich in
einer weit dünneren Form auch auf sonnigen Felsen, so bei Meran,
mit Braunia und Campylopus polytrichoides.
104. Cylindrothecium Schpr.
H a u p t s t e n g e l a u f s te ig e n d , zerstreut oder fast fiederig
beästet. Früchte auf Stengel und Ha u p t ä s te n sitzend. B l ä t t e r
v e r f la c h t , ohne R ip p e , u n g e f a l te t . Z e l le n am o b e r e n
B l a t t th e i l e l in e a l , u n ten noch l ä n g e r , an den B l a t t f lü g
e ln b la s ig aufgetrieben, mit quadratischen Zellen. Zähne des
äusseren Peristoms breit-lanzeftlich-lang zugespitzt; mit deutlicher
Theilungslinie, auf der Innenfläche undeutlich mit vortretenden
Querleisten, frei. F o r t s ä t z e des in n e r e n P e r is toms f re i
oder am Grunde aus .sehr schmaler Membran entspringend, von
zwei parallelen, in der Theilungslinie oft durchbrochenen Zellreihen
gebildet. Perichätium auf kurzem, wurzelndem Aste, lang. H a u b e
ü b e r die g a n z e Kapsel hinabgezogen.
437. C. concimmm Schpr. (C. insidiosum Buse. — C. Montagnei
Brch. et Schpr. — Entodon C. Müll. — Hypnum
insidiosum Mont. - - H. orthocarpum La Pyl. —).
Zwe ihäus ig . Rasen dicht. Ste n g e l aufrecht, wurzellos,
ganz regelmässig durch Aeste g e f ie d e r t , goldgelhlich und goldgrün,
unten dunkler, glänzend. B l ä t t e r trocken anliegend, breii-
e i tö rmig oder e i fö rmig - lä n g l ic h , s tumpf , h o h l , g a n z r
a n d ig , oben einwärts-, unten etwas zu r ü c k g e s ch la g e n . Kapsel
langgestielt, cylindrisch, mit kurzem Halse, Deckel kegelförmig,
stumpflich. Zähne des äusseren Peristoms unten dunkelbraun, gestrichelt,
oben bleich, glatt.
Auf kalkhaltigem Boden und auf Kalkfelsen. — W e t t e r a u : Im Münsterlande
auf Wiesen und Brachländern häufig; Teutoburger Wald; Wesergebirge;
Sauerland. — T h ü r in g e n : Schnepfenthal bei Gotha (Röse). ~ Freiburg a. d.
U n s t r u t . — B a d e n . — O b e r f r a n k e n . — S a a r b r ü c k e n . — H o lla n d ,
sehr selten (Buse). — Herbst.
Diese in Schlesien vielleicht noch zu entdeckende, besonders
Kalkboden liebende Art erinnert in ihrer Tracht sehr an Hypnum
Schreberi und erscheint höchst selten mit Früchten. Durch ihre
Färbung ist sie am besten von H. Schreberi zu unterscheiden.
438. C. cladorrhizans Schpr. (Neckera cladorrhizans Hedw.
— Entodon C. Müll. — Isothecium Schleicher! Schpr. —■
Anomodon cladorrhizans Hüb. — C. Schleicheri B. S.).
E in h äu s ig . Rasen niedergedrückt, gelb- bis goldgrün glänzend,
S te n g e l unregelmässig fie de r ästig. B l ä t t e r etwas locker
und verflacht, aus schmälerem Grunde e i fö rmig bis lä n g l ic h ,
g e s p i t z t , hohl, am Rande n ic h t um g e ro l l t , an der Spitze gezähnelt.
Kapseln gehäuft, cylindrisch mit verschmälerter Mündung,
roth; Deckel kegelig, stumpf. Zähne des äusseren Peristoms roth,
gestrichelt, des inneren gelb.
An grasigen Plätzen, an Felsen und am Grunde der Baumstämme. Auf Jurakalkblöcken
des Rötteler Schlosses bei Lörrach in B a d e n (A. Br.). — M ü n c
h e n (Lorentz). Herbst.
Diese Art, welche im Süden sehr verbreitet ist, kann mit voriger
schon wegen des weit kräftigeren Wuchses und der unregelmässigen
Beästung nicht verwechselt werden.
Tribus 47. Pylaisieae.
Haub e bis zur K a p s e lm i t te hinabgezogen. P e r i s tom stets
d o p p e l t : in n e r e s am Grunde auf einer'se hr hoh en , se ch s z
e h nma l k ie l ig g e f a l t e t e n H a u t aufsitzend, die Fortsätze
des inneren Peristoms fast immer von der Länge der Zähne des
äusseren. Wimp e rn me i s t v o rh a n d e n .