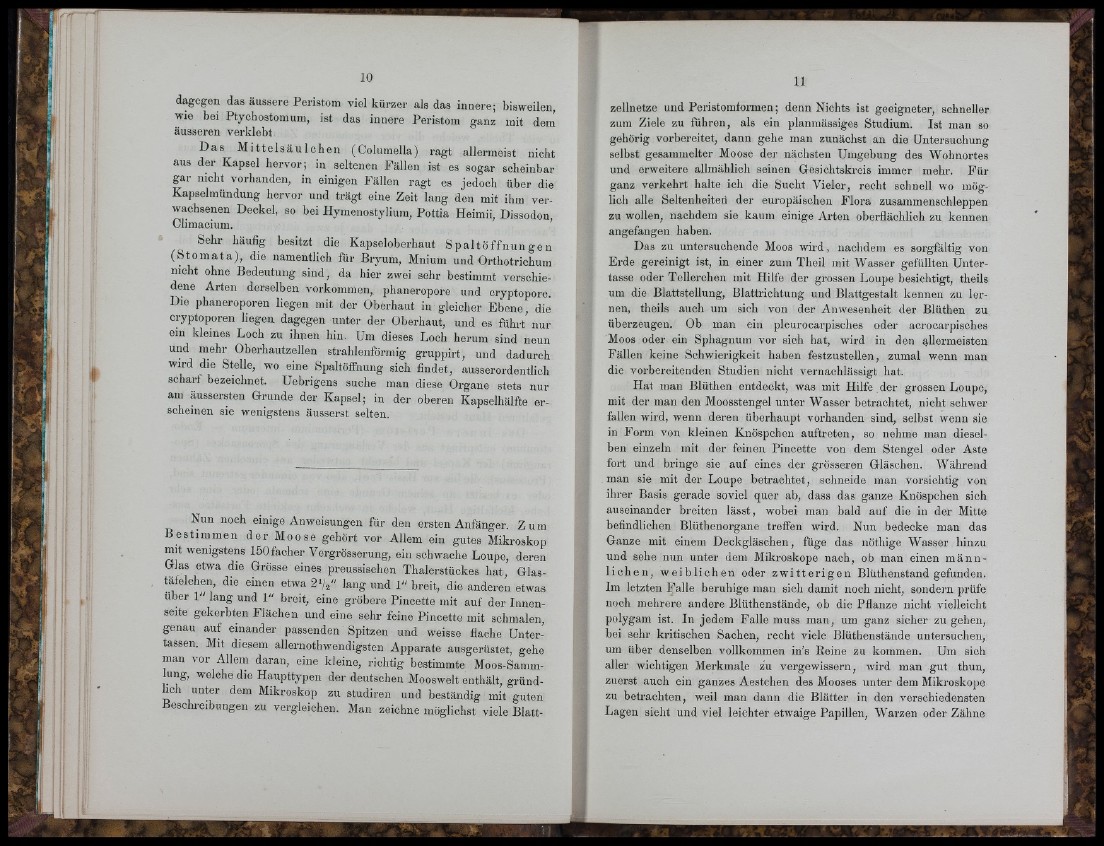
dagegen das äussere Peristom viel kürzer als das innere; bisweilen,
wie bei Ptychostomum, ist das innere Peristom ganz mit dem
äusseren verklebt
D a s Mi t t e l sä ul che n (Columella) ragt allermeist nicht
aus der Kapsel hervor; in seltenen Fällen ist es sogar scheinbar
gar nicht vorhanden, in einigen Fällen ragt es jedoch über die
Kapselmündung hervor und trägt eine Zeit lang den mit ihm verwachsenen
Deckel, so bei Hymenostylium, Pottia Heimii, Dissodon
Climacium. ’
Sehr häufig besitzt die Kapseloberhaut Sp a l t ö f f nu ng en
(Stomata) , die namentlich für Bryum, Mnium und Orthotrichum
nicht ohne Bedeutung sind, da hier zwei sehr bestimmt verschiedene
Arten derselben Vorkommen, phaneropore und cryptopore.
Die phaneroporen liegen mit der Oberhaut in gleicher Ebene, die
cryptoporen liegen dagegen unter der Oberhaut, und es führt' nur
ein kleines Loch zu ihnen hin. Um dieses Loch herum sind neun
und mehr Oberhautzellen strahlenförmig gruppirt, und dadurch
wird die Stelle, wo eine Spaltöfi’nung sich findet, ausserordentlich
scharf bezeichnet. Uebrigens suche mau diese Organe stets nur
am äussersten Grunde der Kapsel; in der oberen Kapselhälfte erscheinen
sie wenigstens äusserst selten.
Nun noch einige Anweisungen für den ersten Anfänger. Zum
Best immen der Moose gehört vor Allem ein gutes Mikroskop
mit wenigstens löOfacher Vergrösserung, ein schwache Loupe, deren
Glas etwa die Grösse eines preussischen Thalerstückes hat, Glas-
tädelchen, die einen etwa lang und 1" breit, die anderen etwas
Uber 1" lang und 1" breit, eine gröbere Pincette mit auf der Innenseite
gekerbten Flächen und eine sehr feine Pincette mit schmalen,
genau auf einander passenden Spitzen und weisse flache Untertassen.
Mit diesem allernothwendigsten Apparate ausgerüstet, gehe
man vor Allem daran, eine kleine, richtig bestimmte Moos-Sammlung,
welche die Haupttypen der deutschen Mooswelt enthält, gründlich
unter dem Mikroskop zu studiren und beständig mit guten
Beschreibungen zu vergleichen. Man zeichne möglichst viele Blattzellnetze
und Peristomformen; denn Nichts ist geeigneter, schneller
zum Ziele zu führen, als ein planniässiges Studium. Ist man so
gehörig vorbereitet, dann gehe man zunächst an die Untersuchung
selbst gesammelter Moose der nächsten Umgebung des Wohnortes
und erweitere allmählich seinen Gesichtskreis immer mehr. Für
ganz verkehrt halte ich die Sucht Vieler, recht schnell wo möglich
alle Seltenheiten der europäischen Flora zusammenschleppen
zu wollen, nachdem sie kaum einige Arten oberflächlich zu kennen
angefangen haben.
Das zu untersuchende Moos wird, nachdem es sorgfältig von
Erde gereinigt ist, in einer zum Theil mit Wasser gefüllten Untertasse
oder Teilerchen mit Hilfe der grossen Loupe besichtigt, theils
um die Blattstellung, Blattrichtung und Blattgestalt kennen zu lernen,
theils auch um sich von der Anwesenheit der Blüthen zu
überzeugen. Ob man ein pleurocarpisches oder acrocarpisches
Moos oder ein Sphagnum vor sich hat, wird in den allermeisten
Fällen keine Schwierigkeit haben festzustellen, zumal wenn man
die vorbereitenden Studien nicht vernachlässigt hat.
Hat man Blüthen entdeckt, was mit Hilfe der grossen Loupe,
mit der man den Moosstengel unter Wasser betrachtet, nicht schwer
fallen wird, wenn deren überhaupt vorhanden sind, selbst wenn sie
in Form von kleinen Knöspchen auftreten, so nehme man dieselben
einzeln mit der feinen Pincette von dem Stengel oder Aste
fort und bringe sie auf eines der grösseren Gläschen. AVährend
man sie mit der Loupe betrachtet, schneide man vorsichtig von
ihrer Basis gerade soviel quer ab, dass das ganze Knöspchen sich
auseinander breiten lässt, wobei man bald auf die in der Mitte
befindlichen Blüthenorgane treffen wird. Nun bedecke man das
Ganze mit einem Deckgläschen, füge das nöthige Wasser hinzu
und sehe nun unter dem Mikroskope nach, ob man einen mä n n l
ichen, weibl ic he n oder zwi t t e r ig en Blüthenstand gefunden.
Im letzten Falle beruhige man sich damit noch nicht, sondern prüfe
noch mehrere andere Blüthenstände, ob die Pflanze nicht vielleicht
polygam ist. In jedem Falle muss man, um ganz sicher zu gehen,
bei sehr kritischen Sachen, recht viele Blüthenstände untersuchen,
um über denselben vollkommen in’s Beine zu kommen. Um sich
aller wichtigen Merkmale zu vergewissern, wird man gut thun,
zuerst auch ein ganzes Aestchen des Mooses unter dem Mikroskope
zu beü’achten, weil man dann die Blätter in den verschiedensten
Lagen sieht und viel leichter etwaige Papillen, Warzen oder Zähne