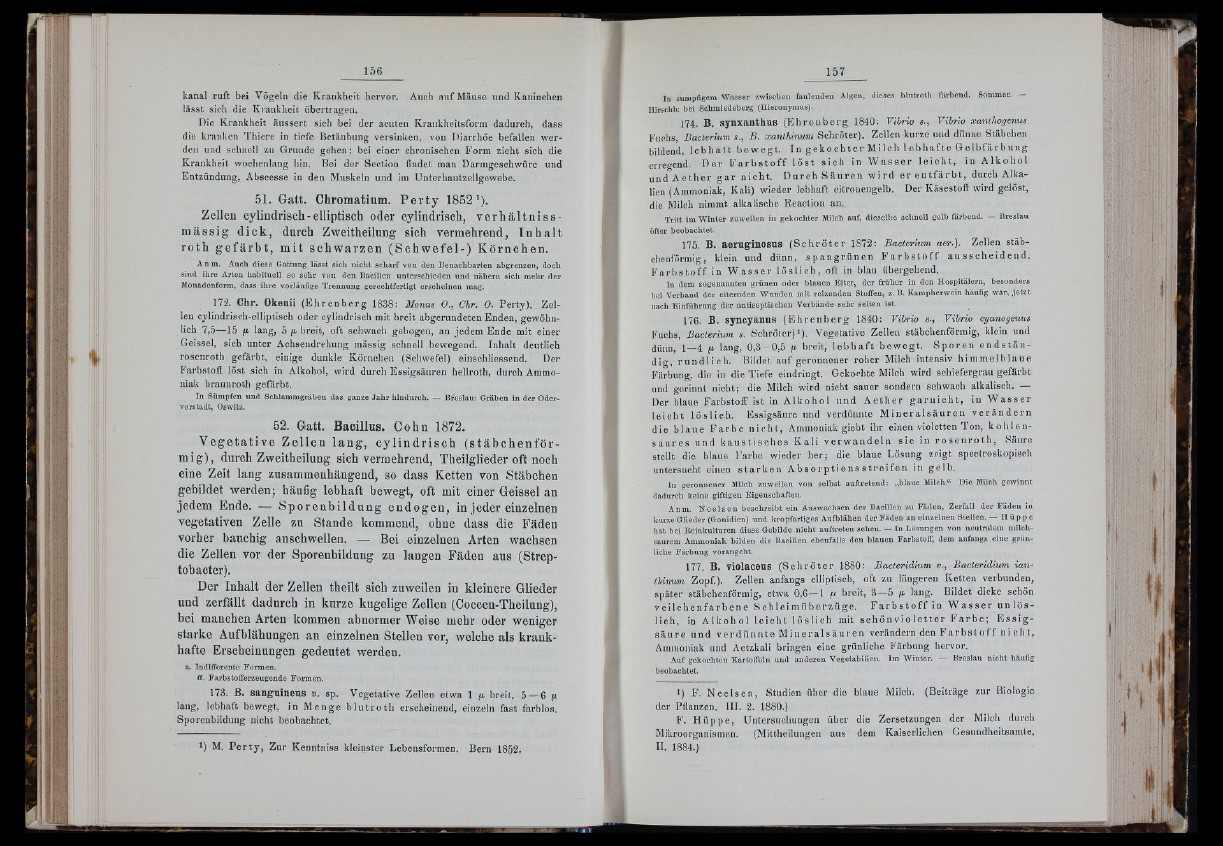
kanal ruft bei Vögeln die Krankheit hervor. Auch auf Mäuse und Kaninchen
lässt sich die Krankheit übertragen.
Die Krankheit äussert sich bei der acuten Krankheitsform dadurch, dass
die kranken Thiere in tiefe Betäubung versinken, von Diarrhöe befallen wer den
und schnell zu Grunde gehen; bei einer chronischen Form zieht sich die
Krankheit wochenlang hin. Bei der Section findet man Darmgeschwüre und
Entzündung, Abscesse in den Muskeln und im Unterhautzellgewebe.
51. Gatt. Ghromatium. P e r t y 1852’).
Zellen cylindrisch-elliptisch oder cylindrisch, v e r h ä l t n i s s -
m a s si g d ic k, durch Zweitheilung sich vermehrend, I n h a l t
roth g e f ä r b t , mi t s c h w a r z e n ( S c hwef e l - ) Körnc hen.
A nm . Auch diese Gattung lässt sich n ich t scharf von den Benachbarten abgrenzen, doch
sind ihre Arten habituell so sehr von den Bacillen unterschieden un d n ähern sich mehr der
Monadenform, dass ih re vorläufige Trennung gerechtfertigt erscheinen mag.
172. Chr. Okenii ( E h r e n b e r g 1838: Monas 0., Chr. 0 . Perty ). Zel-
leu cylindrisch-elliptisch oder cylindrisch mit breit abgerundeten Enden, gewöhnlich
7,5—15 (I lang, 5 y breit, oft schwach gebogen, an jedem Ende mit einer
Geissel, sich unte r Achsendrehung mässig schnell bewegend. Inhalt deutlich
rosenroth gefärbt, einige dunkle Körnchen (Schwefel) einschliessend. Der
B'arbstofi löst sich in Alkohol, wird durch Essig säuren hellroth, durch Ammoniak
braunroth gefärbt.
In Sümpfen und Schlammgräben das ganze J a h r hindurch. — Breslau: Gräben in der Odervorstadt,
Oswitz.
52. Gatt. Bacillus. Cohn 1872.
V e g e t a t i v e Z el l en l ang, c y l i n d r i s c h ( s t ä b c h e n f ö r mig)
, durch Zweitheilung sich vermehrend, Theilglieder oft noch
eine Zeit lang zusammenhängend, so dass Ketten von Stäbchen
gebildet werden; häufig lebhaft bewegt, oft mit einer Geissel an
jedem Ende. — S p o r e n b i l d u n g endogen, in jeder einzelnen
vegetativen Zelle zu Stande kommend, ohne dass die Fäden
vorher bauchig anschwellen. — Bei einzelnen Arten wachsen
die Zellen vor der Sporenbildung zu langen Fäden aus (Strep-
tobaeter).
Der Inhalt der Zellen theilt sich zuweilen in kleinere Glieder
und zerfällt dadurch in kurze kugelige Zellen (Coccen-Theilnng),
hei manchen Arten kommen abnormer Weise mehr oder weniger
starke Aufblähungen an einzelnen Stellen vor, welche als krankhafte
Erscheinungen gedeutet werden.
a. Indifferente Formen.
«. Farbstofferzeugende Formen.
173. ß . s a a g u in e u s n. sp. Vegetative Zellen etwa 1 jx breit, 5 — 6 (x
lang, lebhaft bewegt, in M e n g e b l u t r o t l i erscheinend, einzeln fast farblos.
Sporenbildung nicht beobachtet.
In sumpfigem Wasser zwischen faulenden Algen, dieses blutrotli färbend. Sommer. -
Hirscbb; bei Schmiedeberg (Hieronymus).
174. B. s y n x a n th n s ( E l i r e n b e r g 1840: Vibrio s., Vibrio xantiiogenus
Fuchs, Bacterium s., B . xanthinum Schröter). Zellen kurze und dünne Stäbclien
bildend, l e b h a f t b e w e g t . In g e k o c h t e r M i l c h l e b h a f t e G e l b f ä r b u n g
erregend. D e r F a r b s t o f f l ö s t s i c h in W a s s e r l e i c h t , in A l k o h o l
u n d A e t h e r g a r n i c h t . D u r c h S ä u r e n w i r d e r e n t f ä r b t , durch Alkalien
(Ammoniak, Kali) wieder lebhaft citronengelb. Der Käsestoff wird gelöst,
die Milch nimmt alkalische Reaction an.
Tritt im Winter zuweilen in gekochter Milch auf, dieselbe schnell gelb färbend. — Breslau
öfter beobachtet.
175. B. a e rn g in o su s ( S c h r ö t e r 1872: Bacterium aer.). Zellen stäbchenförmig,
klein und dünn, s p a n g r f l n e n F a r b s t o f f a u s s c h e i d e n d .
F a r b s t o f f in W a s s e r l ö s l i c h , oft in blau übergehend.
In dem sogenannten grünen oder blauen Eiter, der früher in den Hospitälern, besonders
bei Verband der eiternden Wunden mit reizenden Stoffen, z. B. Kampherwein häufig war, je tz t
nach Einführung der antiseptischen Verbände seh r selten ist.
176. B. syncyanus ( E h r e n b e r g 1840: Vibrio s., Vibrio cyanogenus
Fuchs, Bacterium s. Scliröteij') . Vegetative Zellen stäbchenförmig, klein und
dümi, 1—4 fl lang, 0,3 - 0,5 fi breit, l e b h a f t b ew e g t . S p o r e n e n d s t ä n d
ig , r u n d l i c h . Bildet auf geronnener roher Milch intensiv h im m e l b l a u e
Färbung, die in die Tiefe eindringt. Gekochte Milch wird schiefergrau gefärbt
und gerinnt nicht; die Milch wird nicht sauer sondern schwach alkalisch. —
Der blaue Farbs toff ist in A l k o h o l u n d A e t h e r g a r i i i c h t , in W a s s e r
l e i c h t l ö s l i c h . Essigsäure und verdünnte M i n e r a l s ä u r e n v e r ä n d e r n
d i e b l a u e F a r b e n i c h t , Ammoniak giebt ihr einen violetten Ton, k o h l e n s
a u r e s u n d k a u s t i s c h e s K a l i v e rw a n d e l n s i e in r o s e n r o t h , Säure
stellt die blaue l'arbe wieder her; die blaue Lösung zeigt speetroskopisch
untersucht einen s t a r k e n A b s o r p t i o n s s t r e i f e n in g e lb .
In geronnener Milcii zuweilen von selbst auftretend; „blaue Milcb.“ Die Milch gewinnt
dadurch keine giftigen Eigensclraften.
Anm. N e e l s e n beschreibt ein Auswachsen der Bacillen zu Fäden, Zerfall der Fäden in
kurze Glieder (Gonidien) und kropfartiges Aufblähen der F äden an einzelnen Stellen. — H ü p p e
hat bei Reinkulturen diese Gebilde nich t auftreten sehen. — In Lösungen von neutralem milchsaurem
Ammoniak bilden die Bacillen ebenfalls den blauen Farbstoff, dem anfangs eine grünliche
Färbung vorangeht.
177. B. violacens ( S c h r ö t e r 1880: Baeteridium v., Baeteridium ian-
tUnum Zopf.). Zellen anfangs elliptisch, oft zu längeren Ketten verbunden,
späte r stäbchenförmig, etwa 0,6— 1 breit, 3—5 fi lang. Bildet dicke schön
v e i l c h e n f a r b e n e S o h l e im ü b e r z ü g e . F a r b s t o f f in W a s s e r u n l ö s l
i c h , in A l k o h o l l e i c h t l ö s l i c h mit s c h ö n v i o l e t t e r F a r b e ; E s s i g s
ä u r e u n d v e r d ü n n t e M i n e r a l s ä u r e n verändern den F a r b s t o f f n i c h t ,
Ammoniak und Aetzkali bringen eine grünliche Färbung hervor.
Auf gekochten Kartoffeln und anderen Vegetabilien. Im Winter. — Breslau nicht häuflg
beobachtet.
1) M. P e r t y , Zur Kemitniss kleinster Lebensformen. Bern 1852,
1) F. N e e l s e n , Studien iiher die blaue Milch. (Beiträge zur Biologie
der Pflanzen. III. 2. 1880.)
F. H ü p p e , Unte rsuchungen über die Zersetzungen der Milch durch
Mikroorganismen. (Mittheilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte,
n . 1884.)
I