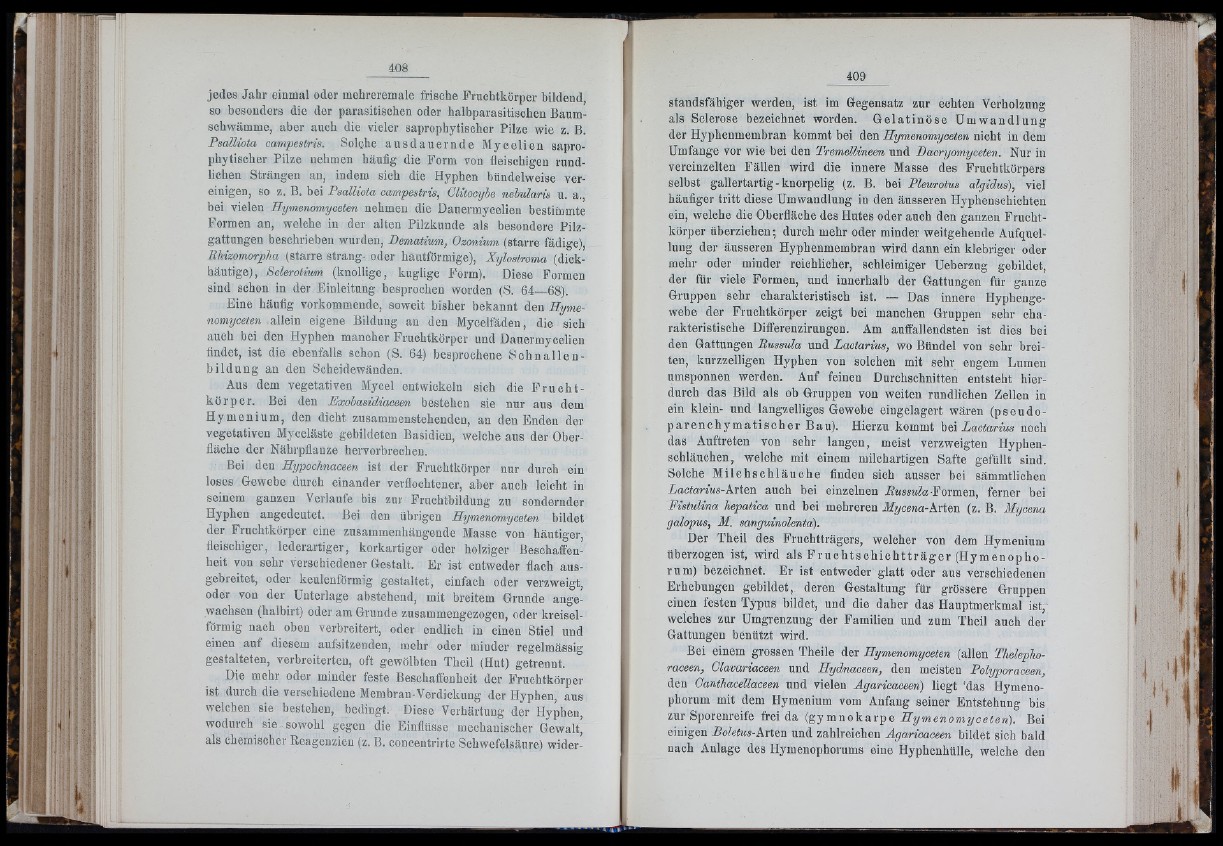
■1U ■ i
i •:
i
: ,1
'’U
jedes Jahr einmal oder mehreremale frische Fruchtkörper bildend,
so besonders die der parasitischen oder halbparasitischen Baumschwämme,
aber auch die vieler saprophytischer Pilze wie z. B.
Psalliota campestris. Solche a u s d a u e r n d e Mycel i en saprophytischer
Pilze nehmen häufig die Form von fleischigen rundlichen
Strängen an, indem sich die Hyphen bündelweise vereinigen,
so z. B. bei Psalliota campestris, Glitocybe nebularis u. a.,
bei vielen Hijmenomyceten nehmen die Dauermycelien bestimmte
Formen an, welche in der alten Pilzkunde als besondere Pilzgattungen
beschrieben wurden, Dematium, Ozonium (starre fädige),
Bhizomorpha (starre Strang- oder hautförmige), Xylostroma (dickhäutige),
Sclerotium (knollige, kuglige Form). Diese Formen
sind schon in der Einleitung besprochen worden (S. 64—68).
Eine häufig vorkommende, soweit bisher bekannt den Hymenomyceten
allein eigene Bildung an den Mycelfäden, die sich
auch bei den Hyphen mancher Fruchtkörper und Dauermycelien
findet, ist die ebenfalls schon (S. 64) besprochene S c h n a l l e n bi
ldung an den Scheidewänden.
Aus dem vegetativen Mycel entwickeln sich die F r u c h t körper
. Bei den Exobasidiaoeen bestehen sie nur aus dem
Hymen i um , den dicht zusammenstehenden, an den Enden der
vegetativen Myceläste gebildeten Basidien, welche ans der Oberfläche
der Nährpflanze hervorbrechen.
Bei den Hypoohnaceen ist der Fruchtkörper nur durch ein
loses Gewebe durch einander verflochtener, aber auch leicht in
seinem ganzen Verlaufe bis zur Fruchtbildung zu sondernder
Hyphen angedeutet. Bei den übrigen Hymenomyceten bildet
der Fruchtkörper eine zusammenhängende Masse von häutiger,
fleischiger, lederartiger, korkartiger oder holziger Beschaffenheit
von sehr verschiedener Gestalt. Er ist entweder flach ausgebreitet,
oder keulenförmig gestaltet, einfach oder verzweigt,
oder von der Unterlage abstehend, mit breitem Grunde angewachsen
(halbirt) oder am Grunde zusammengezogen, oder kreiselförmig
nach oben verbreitert, oder endlich in einen Stiel und
einen auf diesem aufsitzenden, mehr oder minder regelmässig
gestalteten, verbreiterten, oft gewölbten Theil (Hut) getrennt.
Die mehr oder minder feste Beschaffenheit der Fruchtkörper
ist durch die verschiedene Membran-Verdickung der Hyphen, aus
welchen sie bestehen, bedingt. Diese Verhärtung der Hyphen,
wodurch sie sowohl gegen die Einflüsse mechanischer Gewalt,
als chemischer Reagenzien (z. B, concentrirte Schwefelsäure) wider^
standsfähiger werden, ist im Gegensatz zur echten Verholzung
als Solerose bezeichnet worden. Ge l a t in ös e Umwa n d l u n g
der Hyphenmembran kommt bei den Hymenomyceten nicht in dem
Umfange vor wie bei den Tremellineen und Dacryomyceten. Nur in
vereinzelten Fällen wird die innere Masse des Fruchtkörpers
selbst gallertartig-knorpelig (z. B. bei Pleurotus algidus), viel
häufiger tritt diese Umwandlung in den äusseren Hyphensehichten
ein, welche die Oberfläche des Hutes oder auch den ganzen Fruchtkörper
überziehen; durch mehr oder minder weitgehende Aufquellung
der äusseren Hyphenmembran wird dann ein klebriger oder
mehr oder minder reichlicher, schleimiger Ueberzug gebildet,
der für viele Formen, und innerhalb der Gattungen für ganze
Gruppen sehr charakteristisch ist. — Das innere Hyphengewebe
der Fruchtkörper zeigt bei manchen Gruppen sehr charakteristische
Differenzirnngen. Am auffallendsten ist dies bei
den Gattungen Bussula und Lactarius, wo Bündel von sehr breiten,
kurzzeiligen Hyphen von solchen mit sehr engem Lumen
umsponnen werden. Auf feinen Durchschnitten entsteht hierdurch
das Bild als ob Gruppen von weiten rundlichen Zellen in
ein klein- und langzeiliges Gewebe eingelagert wären (pseudo-
p a r e n c h yma t i s c h e r Bau). Hierzu kommt h ú Lactarius noch
das Auftreten von sehr langen, meist verzweigten Hyphen-
schläuohen, welche mit einem milchartigen Safte gefüllt sind.
Solche Mi l e h s c h lä uc h e finden sich ausser bei sämmtlichen
Lactarius-kiiQU auch bei einzelnen ifwssMfa Formen, ferner bei
Fistulina hepática und bei mehreren Mycena-kxio,D. (z. B. Mycena
galopus, M. sanguinolenta).
Der Theil des Fruehtträgers, welcher von dem Hymenium
überzogen ist, wird als F r u c h t s c h i c h t t r ä g e r (Hymenopho-
rum) bezeichnet. Er ist entweder glatt oder aus verschiedenen
Erhebungen gebildet, deren Gestaltung für grössere Gruppen
einen festen Typus bildet, und die daher das Hauptmerkmal ist,
welches zur Umgrenzung der Familien und zum Theil auch der
Gattungen benützt wird.
Bei einem grossen Theile der Hymenomyceten (allen Thelepho-
raceen, Glavariaceen und Hydnaceen, den meisten Polyporaceen,
den Ganthacellaceen und vielen Agaricaceen) liegt 'das Hymeno-
phorum mit dem Hymenium vom Anfang seiner Entstehung bis
zur Sporenreife frei da ( g y m n ok a r p e Hymenomyceten) . Bei
einigen Boletus-knm nnd zahlreichen Agaricaceen bildet sich bald
nach Anlage des Hymenophorums eine Hyphenhülle, welche den
lii
i I
l ’f f , t'l Ul