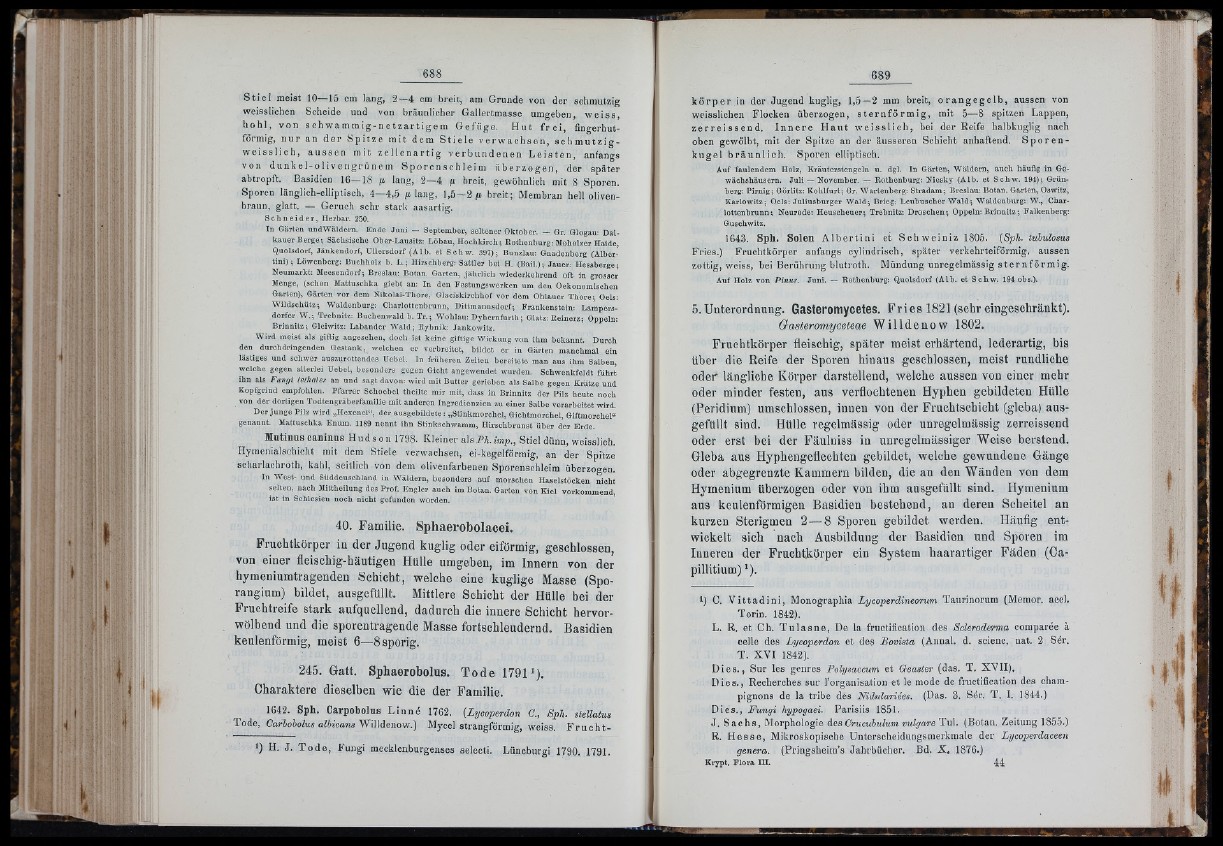
, f t
L i
S t ie l meist 10— 15 cm lang, 2—4 cm breit, am Grunde von der schmutzig
weisslichen Scheide und von bräunlicher Gallertmasse umgeben, w e is s ,
h o h l, von s c h w am m ig -n e tz a r t ig em G efüge. H u t f r e i , fingerhutförmig,
n u r an d e r S p it z e mit dem S t ie le v e rw a c h s e n , s c lim u t z ig -
v /e is s l!c h , a u s se n rait z e lle n a r t ig v e rb u n d e n e n L e is t e n , anfangs
von d u n k e l-o liv e n g rü n e in S p o re n s c lile im ü b e rz o g e n , der später
abtropft. Basidien 1 6 - 1 8 fi lang, 2 - 4 fi breit, gewöhnlich mit 8 Sporen.
Sporen länglich-elliptisch, 4— 4,5 «lang, 1,5—2 « breit; Membran hell olivenbraun,
glatt. — Geruch sehr stark aasartig.
S c h n e i d e r , Herbar. 2.50.
In Gärten nndWäldern. Ende Juni — September, seltener Oktober. — Gr. Glogau: Dalk
auer Berge; Sächsische Ober-Lausitz: Löbau, Hochkirch; Eothenburg: Moholzer Haide,
Quolsdorf, Jänkendorf, Dllersdorf (A lb . et S c h w . 397); Bunzlau: Gnadenberg (Albertin
i); Löwenberg: Euchholz b. L.; Hirschberg: Sattler bei H. (Bail.); Jauer; Hessberge;
Neumarkt: Meesendorf; Breslau: Botan. Garten, jäh rlich wiederkehrend oft in grosser
Menge, (schon Mattuschka giebt an: In den Festungswerken um deu Oekonomischen
Garten), Gärten vor dem Nikolai-Thore, Glaciskirchhof vor dem Ohlauer Thore; Oels:
Wildschütz; Waldenburg: Charlottenbrunn, Dittmannsdorf; Frankenstein; Lampersdorfer
W.; Trebmtz: Buchenwald b. T r.; Wohlau: Dyhernfurth; Glatz: Eeinerz; Oppeln;
B rinnitz ; Gleiwitz: Labander W ald ; Eybnik: Jankowitz.
Wird meist als giftig angesehen, doch ist keine giftige Wirkung von ihm bekannt. Durch
den durchdringenden Gestank, welchen er verbreitet, bildet er in Gärten manchmal ein
lästiges und schwer auszurottendes Uebel. In früheren Zeiten bereitete man aus ihm Salben,
welche gegen allerlei Uebel, besonders gegen Gicht angewendet wurden. Schwenkfeldt führt
ihn als Fungi lelhales an und sagt davon: wird mit Butter gerieben als Salbe gegen Krätze und
Kopfgrind empfohlen. Pfa rre r Schoebel theilte mir mit, dass in Brinnitz der Pilz heute noch
von der dortigen Todtengräberfamilie mit anderen Ingredienzien zu einer Salbe verarbeitet wird.
Der ju n g e Pilz wird „Hexenei“ der ausgebildete; „Stinkmorchel, Giohtmorchel, Qiftmorchel“
genannt. Mattuschka Enum. 1189 nennt ihn Stinkschwamm, Hirschbrunst über der Erde.
Mutinus caninus H u d so n 1798. Kleiner alsPA.m«., Stiel dünn, weisslich.
Hymenialschicht mit dem Stiele verwachsen, ei-kegelförmig, an der Spitze
scharlachroth, kahl, seitlich von dem olivenfarbenen Sporenschleim überzogen.
In West- und Süddeuscbland ln W'äldern, besonders auf morschen Haselstöcken nicht
selten, nach Mitlheüung des Prof. Engler auch im Botan. Garten von Kiel vorkommend,
ist in Schlesien noch n icht gefunden worden. ’
40. Familie. Sphaerobolacei.
Fruchtkörper in der Jugend kuglig oder eiförmig, geschlossen,
von einer fleischig-häutigen Hülle umgeben, im Innern von der
hymeniumtragenden Schicht, welche eine kuglige Masse (Sporangium)
bildet, ausgefüllt. Mittlere Schicht der Hülle bei der
Fruehtreife stark aufquellend, dadurch die innere Schicht hervorwölbend
und die sporentragende Masse fortschleudernd. Basidien
keulenförmig, meist 6—8 sporig.
245. Gatt. Sphaeroholus. T o d e 1791').
Charaktere dieselben wie die der Familie.
1642. Sph. Carpoholus L in n é 1762. {Lycoperdon C., Sph. stellatus
Tode, Carbololus alhicansWiWàeuow.) Myeel strangförmig, weiss, F r u c h t -
') H. J. T o d e , Fungi mecklenburgenses selecti. Lüneburgi 1790, 1791,
k ö r p e r in der Jugend kugüg, 1,5—2 min breit, o ra n g e g e lb , aussen von
weisslichen B'locken überzogen, s te rn fö rm ig , mit 5—8 spitzen Lappen,
z e r r e is s e n d . In n e r e H a u t w e i s s lic h , bei der Reife halbkuglig nach
oben gewölbt, mit der Spitze an der äusseren Schicht anhaftend. S p o r e n k
u g e l b rä u n lic h , Sporen elliptisch.
Auf faulendem Holz, Kräuterstengeln u. dgl. In Gärten, Wäldern, auch häufig in Gewächshäusern.
Ju li — November. — Rothenburg: Niesky {Alb. et S c hw . 194); Grünberg:
Pirn ig ; Görlitz: Kohlfurt; Gr. Wartenberg: Stradam; Breslau: Botan. Garten, Oswitz,
Karlowitz; Oels: Juliusburger W ald ; Brieg: Leubuscher W ald ; Waldenburg: W., Charlo
tten b ru n n ; Neurode: Heuscheuer; Trebnitz: Droschen; Oppeln: B rin n itz ; Falkenberg:
Guschwitz.
1643. Sph. Solen A lb e r t in i et S c h w e in iz 1805. {Sph. tuhulosm
Fries.) Fruchtkörper anfangs cylindrisch, später verkehrteiförmig, aussen
zottig, weiss, bei Berührung blutroth. Mündung unregelmässig s te rn fö rm ig .
Auf Holz von Pinus. Juni. — Rothenburg: Quolsdorf (Alb. et S c h w . 194 obs.).
5.Unterordnung. Gasteromycetes. F r i e s 1821 (sehr eingeschränkt).
Oasteromyceteae W i l ld e n ow 1802.
Fruchtkörper fleischig, später meist erhärteud, lederartig, bis
über die Reife der Sporeu hinaus geschlossen, meist rundliche
oder längliche Körper darstellend, welche aussen von einer mehr
oder minder festen, aus verflochtenen Hyphen gebildeten Hülle
(Peridium) umschlossen, innen von der Fruchtsohicht (gleha) aus-
gefüllt sind. Hülle regelmässig oder unregelmässig zerreissend
oder erst bei der Fäulniss in unregelmässiger Weise berstend.
Gleba aus Hyphengeflechten gebildet, welche gewundene Gänge
oder abgegrenzte Kammern bilden, die an den Wänden von dem
Hymenium überzogen oder von ihm ausgefüllt sind. Hymenium
aus keulenförmigen Basidien bestehend, an deren Scheitel an
kurzen Sterigmen 2 — 8 Sporen gebildet werden. Häufig entwickelt
sich nach Ausbildung der Basidien und Sporen im
Inneren der Fruchtkörper ein System haarartiger Fäden (Capillitium)
*).
') C. V i t t a d in i, Monographia Lycoperdineorum Taurinorum (Memor. accl.
Torin. 1842).
L. R. et Ch. T u la s n e , De la fructification des Scleroderma comparée à
celle des Lycoperdon et des Bovista (Annal. d. scienc. nat. 2 Sér.
T . X V I 1842).
D ie s . , Sur les genres Polysacoum et Geäster (das. T. X V II) .
D ie s ., Recherches sur l’organisation et le mode de fructification des champignons
de la tribe des Nidulariées. (Das. 3. Sér. T. L 1844.)
D ie s ., F u n g i hypogaei. Parisiis 1851.
J . S a c h s , Morphologie Acs Orucuhulum vulgare Tul. (Botan. Zeitung 1855.)
R. H e s s e , Mikroskopische Unterscheidungsmerkmale der Lycoperdaceen
genera. (Pringsheim’s Jahrbücher. Bd. X . 1876.)
Krypt. F lo ra IU. 44