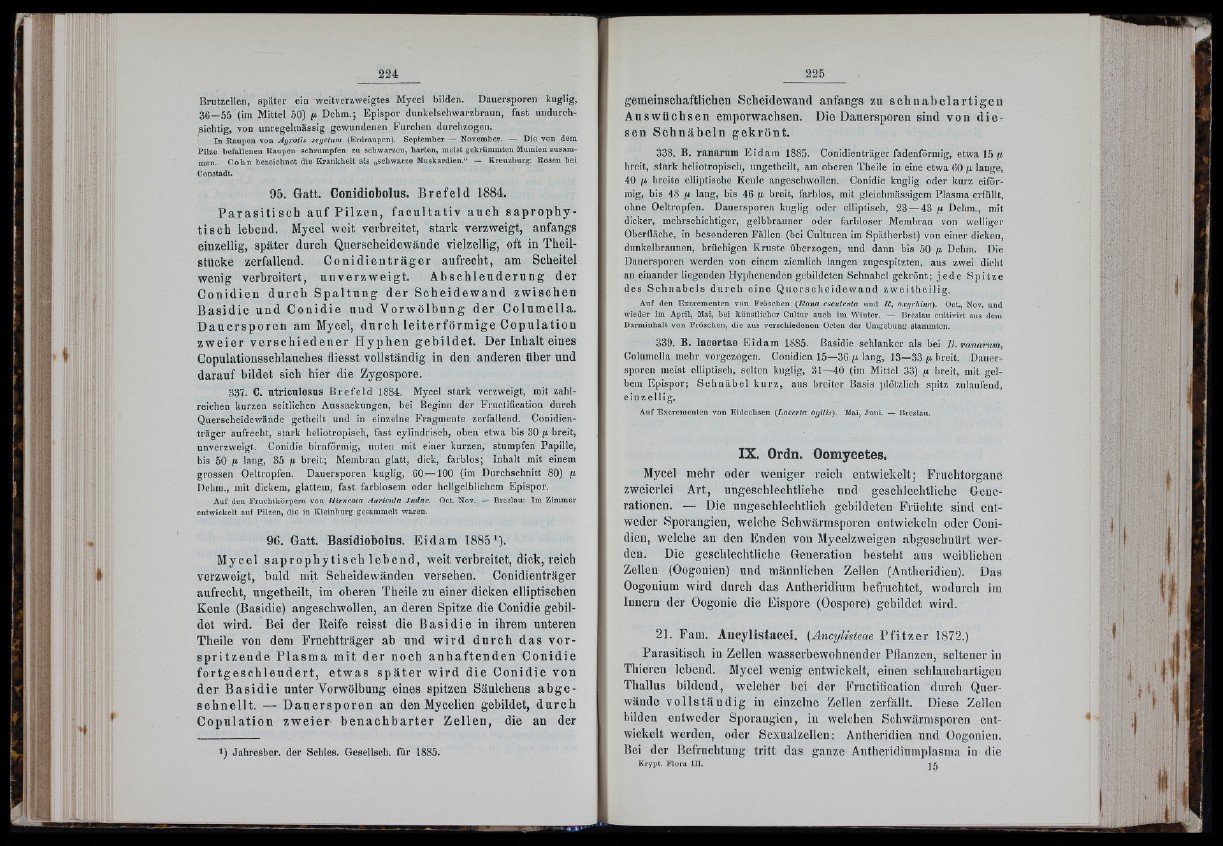
i
r
■Ti
■ i
Li!-
i ' | i
f t
Brutzellen, späte r ein weitverzweigtes Mycel bilden. Dauersporen kuglig,
36—55 (im Mittel 50) g Dchm.; Eplspor dunkelschwarzbraun, fast undurchsichtig,
von unregelmässig gewundenen B'urchen durchzogen.
In Raupen von Agrolis segetum (Erdraupen). September — November. — Die von dem
Pilze befallenen Raupen schrumpfen zu schwarzen, h arten, meist gekrümmten Mumien zusammen.
C o h n bezeichnet die Krankheit als „schwarze Muskardien.“ — Kreuzburg; Rosen bei
Constadt.
95. Gatt. Conidiobolus. Br e f e ld 1884.
P a r a s i t i s c h auf Pi l z en, f a c u l t a t i v auch s a p r o p h y t
i s ch lebend. Mycel weit verbreitet, stark verzweigt, anfangs
einzellig, später dureh Querseheidewände vielzellig, oft in Theil-
stiicke zerfallend. Co n i d i e n t r ä g e r aufrecht, am Scheitel
wenig verbreitert, un ve r zwe igt . Ab s c h l e u d e r u n g der
Coni d i en du r c h S p a l t u n g de r S c h e i d ewa n d zwi s chen
Ba s i d i e und Co ni d i e uud Vor w ö l b u n g der Columel la.
Da u e r s p o r e n am Mycel, dur ch l e i t e r f ö rm i ge Cop ul a t i on
zwei e r v e r s c h i e d e n e r Hy p h e n gebi ldet . Der Inhalt eines
Copulationsschlauches fiiesst vollständig in den anderen über und
darauf bildet sich hier die Zygospore.
337. C. ut r icu lo sn s B r e f e l d 1884. Mycel stark verzweigt, mit zahlreichen
kurzen seitlichen Aussackungen, bei Beginn der Fructification durch
Qiierscheidewände getheilt und in einzelne Fragmente zerfallend. Conidienträger
aufrecht, stark heliotropiseh, fast cylindrisch, oben etwa bis 30 g breit,
unverzweigt. Conidie bimförmig, unten mit einer kurzen, stumpfen Papille,
bis 50 g lang, 35 g breit; Membran glatt, dick, farblos; Inhalt mit einem
grossen Oeltropfen. Dauersporen kuglig, 6 0— 100 (im Durchschnitt 80) g
Dchm., mit dickem, glattem, fast farblosem oder hellgelblichem Epispor.
Auf den Fruchtkörpern von Hirneotn Auricula Judae. Oct. Nov. — Breslau: Im Zimmer
entwickelt auf Pilzen, die in Kleinburg gesammelt waren.
96. Gatt. Basidiobolus. E i d a m 1885*).
Mycel s a p r o p h y t i s c h le bend, weitverbreitet, dick, reich
verzweigt, bald mit Scheidewänden versehen. Conidienträger
aufrecht, ungetheilt, im oberen Theile zu einer dicken elliptischen
Keule (Basidie) angeschwollen, an deren Spitze die Conidie gebildet
wird. Bei der Reife reisst die Ba s i d i e in ihrem unteren
Theile von dem Fruchtträger ab und wi r d d u r c h da s vor -
s p r i t z e n d e P l a sma mi t de r noch a n h a f t e n d e n Coni d i e
f o r t g e s c h l e u d e r t , e t w a s s p ä t e r w ir d die Conidi e von
der B a s i d i e unter Vorwölbung eines spitzen Säulchens a b g e schnel
l t . — Da u e r s p o r e n an den Mycelien gebildet, d u r c h
Copu l a t i o n zwe i e r b e n a c h b a r t e r Zel len, die an der
gemeinschaftlichen Scheidewand anfangs zu s c h n a b e l a r t i g e ü
Auswüc hs e n emporwachsen. Die Dauersporen sind von d i e sen
S c h n ä b e l n gekrönt .
338. B. ra n a rum E i d am 1885. Conidienträger fadenförmig, etwa 15 ft
breit, s tark heliotropiseh, ungetheilt, am oberen Theile in eine etwa 60 g lange,
40 g breite elliptische Keule angeschwollen. Conidie kuglig oder kurz eiförmig,
bis 48 g lang, bis 46 g breit, farblos, mit gleichmässigem Plasma erfüllt,
ohne Oeltropfen. Dauersporen kuglig oder elliptisch, 23 — 43 g Dchm., mit
dicker, mehrschichtiger, gelbbrauner oder farbloser Membran von welliger
Oberfläche, in besonderen Fällen (bc! Culturen !ni Spätherbst) von einer dicken,
diinkelbraimen, brüchigen Kruste überzogen, und dann bis 50 g Dchm. Die
Dauersporen werden von einem ziemlich langen zugespitzten, aus zwei dicht
an einander liegenden Hyphenenden gebildeten Schnabel gekrönt; j e d e S p i t z e
d e s S c h n a b e l s d u r c h e in e Q u e r s c h e l d e w a n d z w e i t h e i l i g .
Auf den Excrementen von Fröschen (Rann esculenta und U. oxiß'hinn). Oct., Nov. und
wieder im April, Mai, bei künstlicher Cultur auch im Winter. — Breslau cultivirt aus dem
Darminhalt von Fröschen, die aus verschiedenen Orten der Umgebung stammten.
339. B. la c e r ta e E i d am 1885. Basidie schlanker als bei B . ranarum,
Columella mehr vorgezogen. Conidien 15—36 jz l.ang, 13—33 fi breit. Dauersporen
meist elliptisch, selten kuglig, 31—40 (im Mittel 33) g breit, mit gelbem
Eplspor; S c h n ä b e l k u r z , .aus breiter Basis plötzlich spitz zulaufend,
ei nzel l ig.
Auf Excrementen von Eidechsen (Locerta agilis). Mai, Juni. — Breslau.
IX. Ordn. Oomycetes.
Mycel mehr oder weniger reich entwickelt; Fruchtorgane
zweierlei Art, ungeschlechtliche und geschlechtliche Generationen.
— Die ungeschlechtlich gebildeten Früchte sind entweder
Sporangien, welche Schwärmsporen entwickeln oder Conidien,
welche an den Enden von Mycelzweigen ahgeschnürt werden.
Die geschlechtliche Generation besteht ans weiblichen
Zellen (Oogonien) und männlichen Zellen (Antheridien). Das
Oogonlnm wird durch das Antheridium befruchtet, wodurch im
Innern der Oogonie die Eispore (Oospore) gebildet wird.
21. Fam. Aiicylistacei. {Ancyh’steae P f i t z e r 1872.)
Parasitisch in Zellen wasserbewohnender Pflanzen, seltener in
Thieren lebend. Mycel wenig entwickelt, einen schlauchartigen
Thallus bildend, welcher bei der Frnctiiication durch Querwände
v o l l s t ä n d i g iu einzelne Zellen zerfällt. Diese Zellen
bilden entweder Sporangien, ln welchen Schwärmsporen entwickelt
werden, oder Sexualzellen; Antheridien und Oogonien.
Bei der Befruchtung tritt das ganze Autheridiumplasma in die
Ki-ypl. Flora III. j j