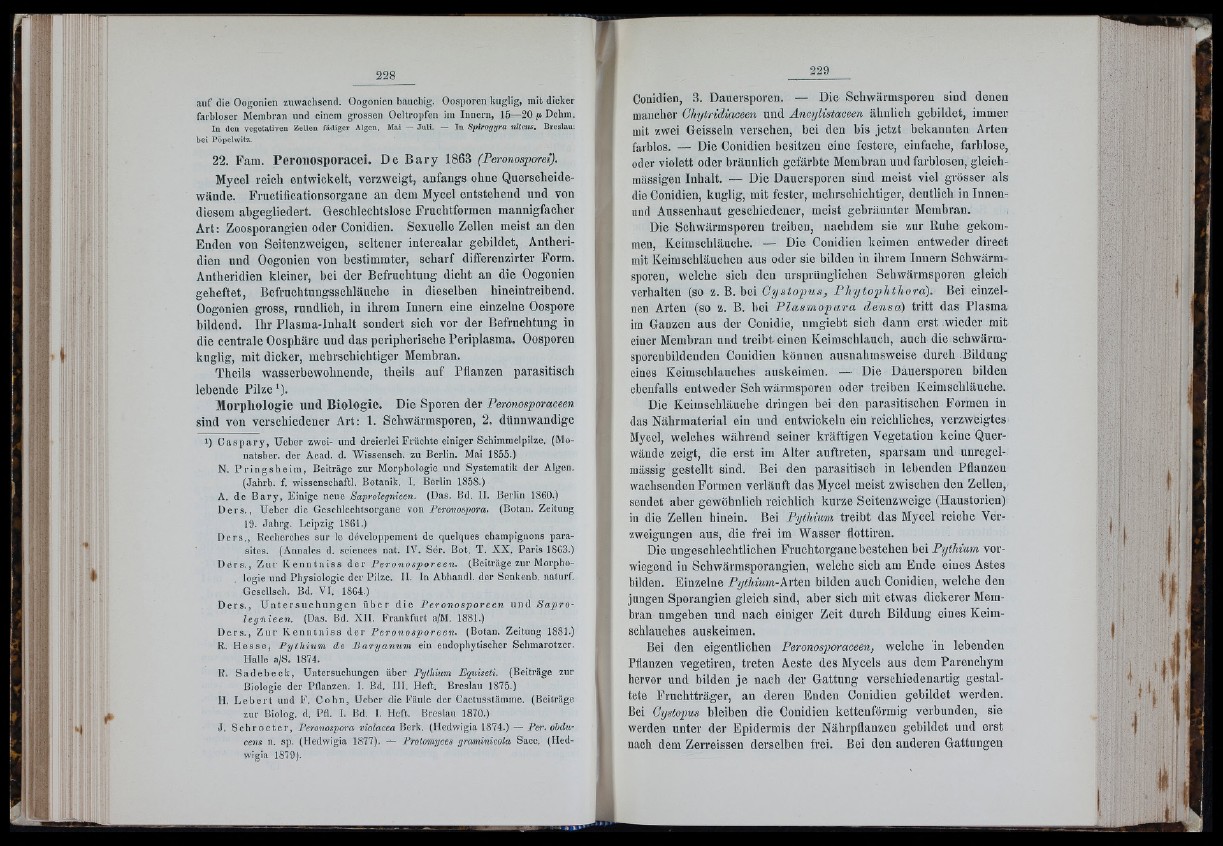
• -iS
i l
■"’ î II
dl
MI!
5
i t
auf die Oogonien zuwachsend. Oogonien bauchig. Oosporen kuglig, mit dicker
far-bloser Membran nnd einem grossen Oeltropfen im Innern, 15—20 ft Dchm.
In den vegetativen Zellen fädiger Algen, Mai — Juli. — In Spiragyra nitens. Bresiau;
bei Pöpelwitz.
22. Fam. Peronosporacei. De Ba r y 1863 (Peronosporei).
Mycel reich entwickelt, verzweigt, anfangs ohne Querscheide-
wände. Fructificationsorgane an dem Mycel entstehend und von
diesem abgegliedert. Geschlechtslose Fruchtformen mannigfacher
Art: Zoosporangien oder Conidien. Sexuelle Zellen meist an den
Enden von Seitenzweigen, seltener intercalar gebildet, Antheridien
und Oogonien von bestimmter, scharf differenzirter Form.
Antheridien kleiner, bei der Befruchtung dicht an die Oogonien
geheftet, Befruchtungsschläuche in dieselben hineintreibend.
Oogonien gross, rundlich, in ihrem Innern eine einzelne Oospore
bildend. Ihr Plasma-Inhalt sondert sich vor der Befruchtung in
die centrale Oosphäre und das peripherische Periplasma. Oosporen
kuglig, mit dicker, mehrschichtiger Membran.
Theils wasserbewohnende, theils auf Pflanzen parasitisch
lebende P ilze’).
Morphologie und Biologie. Die Sporen der Peronosporaceen
sind von verschiedener Art: 1. Schwärmsporen, 2. dünnwandige
1) C a s p a r y , ü e b e r zwei- und dreierlei Früchte einiger Schimmelpilze. (Monatsber.
der Acad. d. Wissensch. zu Berlin. Mai 1855.)
N. P r i n g s h e im , Beitrage zur Morphologie und Systematik der Algen.
(Jahrb. f. wissenschaftl. Botanik. I. Berlin 1858.)
A. d e B a r y , Einige neue Saprolegnieen. (Das. Bd. II. Berlin 1860.)
D e r s . , Ueber die Geschlechtsorgane von Peronospora. (Botan. Zeitung
19. Jahrg. Leipzig 1861.)
D e r s . , Recherches sur le développement de quelques champignons parasites.
(Annales d. sciences nat. IV. Sér. Bot, T. XX. Paris 18G3.)
D é r s . , Z u r K e n n t n i s s d e r P e r o n o s p o r e e n . (Beiträge zur Morphologie
und Physiologie der Pilze. II. In Abhandl. der Senkenb, naturf.
Gesellsch. Bd. VI. 1864.)
D e r s . , U n t e r s u c h u n g e n ü b e r d i e P e r o n o s p o r e e n u n d S a p r o '
le g i i i e e n . (Das. Bd. XI I . Frankfurt a/M. 1881.)
D e r s . , Z u r K e n n t n i s s d e r P e r o n o s p o r e e n . (Botan. Zeitung 1881.)
R. H e s s e , P y t h i u m d e B a r y a n u m ein endophytischer Schmarotzer.
Halle a/S. 1874.
R. S a d e b e c k , Unte rsuchungen über Pythium Equiseti. (Beiträge zur
Biologie der Pflanzen. I. Bd. II I. Heft, Breslau 1875.)
H. L e b e r t und F. C o h n , ü e b e r die Fäule der Cactusstämme. (Beiträge
zur Biolog. d. Pfl. I. Bd. I. Heft. Breslau 1870.)
J. S c h r o e t e r , Peronospora violacea Berk. (Hedwigia 1874.) — Per. ohdu-
cens n. sp. (Hedwigia 1877). ^ Protomyces graminicola Sacc. (Hedwigia
1879J.
Conidien, 3. Dauersporen. — Die Schwärmsporen sind denen
mancher Ohytridiaceen und Ancylistaceen ähnlich gebildet, immer
mit zwei Geissein versehen, bei den bis jetzt bekannten Arten
farblos. — Die Conidien besitzen eine festere, einfache, farblose,
oder violett oder bräunlich gefärbte Membran und farblosen, gleich-
mässigen Inhalt. — Die Dauersporen sind meist viel grösser als
die Conidien, kuglig, mit fester, mehrschichtiger, deutlich in Innen-
und Aussenhaut geschiedener, meist gebräunter Membran.
Die Schwärmsporen treiben, nachdem sie zur Ruhe gekommen,
Keimschläuche. — Die Conidien keimen entweder direct
mit Keimschläuehen aus oder sie bilden in ihrem Innern Schwärmsporen,
welche sich den ursprünglichen Schwärmsporen gleich
verhalten (so z. B. bei Gys topus , Phytophthora) . Bei einzelnen
Arten (so z. B. bei P la smo p a r a densa) tritt das Plasma
im Ganzen aus der Conidie, umgiebt sich dann erst wieder mit
einer Membran und treibt einen Keimschlauch, auch die schwärm-
sporenbildenden Conidien können ausnahmsweise durch Bildung
eines Keimschlauches auskeimen. — Die Dauersporen bilden
ebenfalls entweder Schwärmsporen oder treiben Keimschläuche.
Die Keimschläuche dringen bei den parasitischen Formen in
das Nährmaterial ein und entwickeln ein reichliches, verzweigtes
Mycel, welches während seiner kräftigen Vegetation keine Querwände
zeigt, die erst im Alter auftreten, sparsam und unregelmässig
gestellt sind. Bei den parasitisch in lebenden Pflanzen
wachsenden Formen verläuft das Mycel meist zwischen den Zellen,
sendet aber gewöhnlich reichlich kurze Seitenzweige (Haustorien)
in die Zellen hinein. Bei Pythium treibt das Mycel reiche Verzweigungen
aus, die frei im Wasser flottiren.
Die ungeschlechtlichen Fruchtorgane bestehen bei Pythium vorwiegend
in Schwärmsporangien, welche sich am Ende eines Astes
bilden. Einzelne P y t h i u m - bilden auch Conidien, welche den
jungen Sporangien gleich sind, aber sich mit etwas dickerer Membran
umgeben und nach einiger Zeit durch Bildung eines Keimschlauches
auskeimen.
Bei den eigentlichen Peronosporaceen, welche in lebenden
Pflanzen vegetiren, treten Aeste des Mycels aus dem Parenchym
hervor und bilden je nach der Gattung verschiedenartig gestaltete
Fruchtträger, an deren Enden Conidien gebildet werden.
Bei Gystopus bleiben die Conidien kettenförmig verbunden, sie
werden unter der Epidermis der Nährpflanzen gebildet und erst
nach dem Zerreissen derselben frei. Bei den anderen Gattungen
f i
I