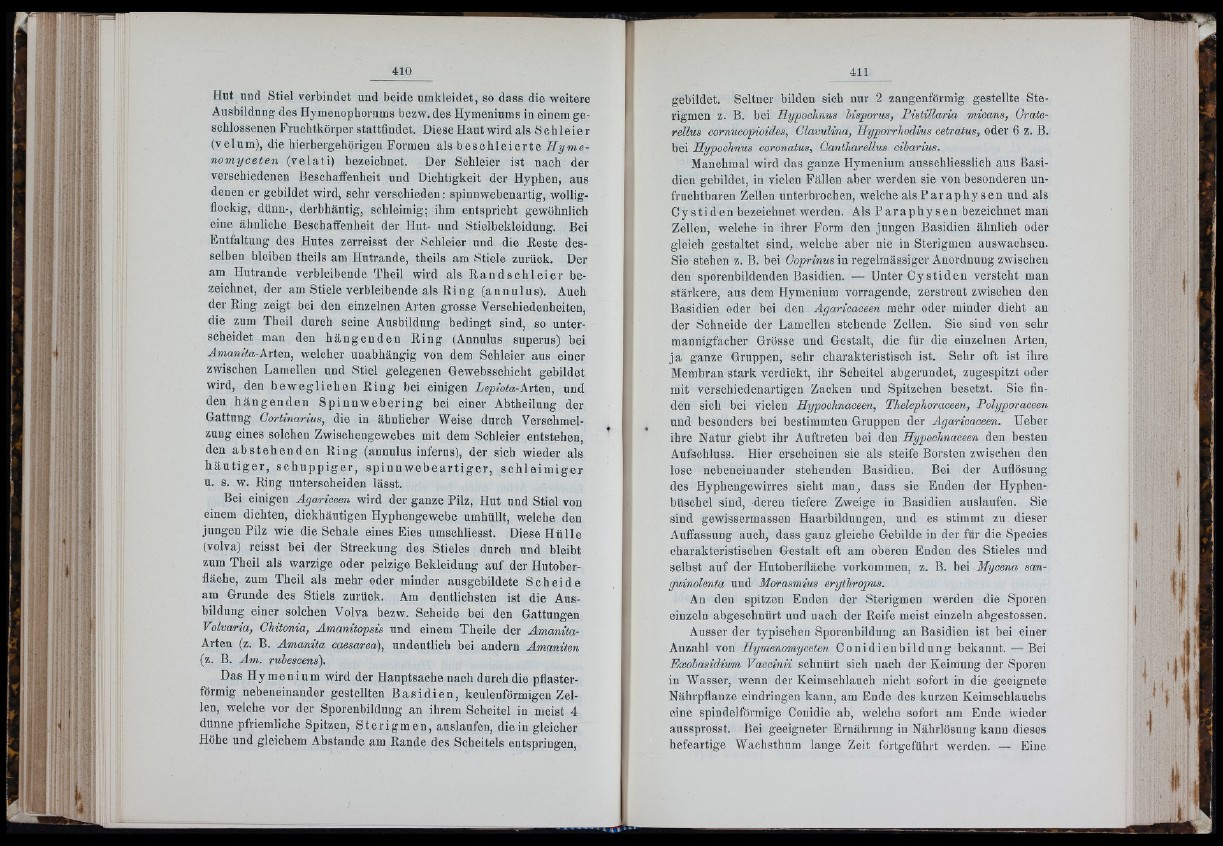
i I
, 't
Hut und Stiel verbindet und beide umkleidet, so dass die weitere
Ausbildung des Hymenophornms bezw. des Hymeniums in einem geschlossenen
Fruchtkörper stattfindet. Diese Haut wird als S c h le ie r
(velum), die hierhergehörigen Formen als b e s c h l e i e r t e Hynie-
nomyoeten (vela ti) bezeichnet. Der Schleier ist nach der
verschiedenen Beschaffenheit und Dichtigkeit der Hyphen, aus
denen er gebildet wird, sehr verschieden : spinnwebenartig, wolligflockig,
dünn-, derbhäutig, schleimig; ihm entspricht gewöhnlich
eine ähnliche Beschaffenheit der Hut- und Stielbekleidung. Bei
Entfaltung des Hutes zerreisst der Schleier nnd die Reste desselben
bleiben theils am Hutrände, theils am Stiele zurück. Der
am Hutrande verbleibende Theil wird als R a n d s c h l e i e r bezeichnet,
der am Stiele verbleibende als R in g (annulus). Auch
der Ring zeigt bei den einzelnen Arten grosse Verschiedenheiten,
die zum Theil durch seine Ausbildung bedingt sind, so unterscheidet
man den h ä n g e n d e n Rin g (Annulus superus) bei
Amanita-krim, welcher unabhängig von dem Schleier aus einer
zwischen Lamellen und Stiel gelegenen Gewebsschicht gebildet
wird, den b ew e g l i c h e n R in g bei einigen Lepiota-kxitn, und
den h ä n g e n d e n S p i n nw e b e r in g bei einer Ahtheilung der
Gattung Gortinarius, die in ähnlicher Weise durch Verschmelzung
eines solchen Zwisohengewebes mit dem Schleier entstehen,
den a b s t e h e n d e n Rin g (annulus inferus), der sieh wieder als
h ä u t i g e r , s c h u p p ig e r , s p i n n w e b e a r t i g e r , s c h l e im i g e r
u. s. w. Ring unterscheiden lässt.
Bei einigen Agariceen wird der ganze Pilz, Hut und Stiel von
einem dichten, dickhäutigen Hyphengewebe umhüllt, welche den
jungen Pilz wie die Schale eines Eies umschliesst. Diese Hü l le
(volva) reisst bei der Streckung des Stieles durch und bleibt
zum Theil als warzige oder pelzige Bekleidung auf der Hutober-
fläche, zum Theil als mehr oder minder ausgebildete S c h e i d e
am Grunde des Stiels zurück. Am deutlichsten ist die Ausbildung
einer solchen Volva bezw. Scheide bei den Gattungen
Volvaria, Ghitonia, Amanitopsis und einem Theile der Amaniia-
Arten (z. B. Amanita caesarea), undeutlich bei ändern Amaniten
(z. B. Am. rubescens).
Das H ym e n ium wird der Hauptsache nach durch die pflasterförmig
nebeneinander gestellten B a s id i e n , keulenförmigen Zellen,
welche vor der Sporenbildung an ihrem Scheitel in meist 4
dünne pfriemliche Spitzen, S t e r igm e n , auslaufen, die in gleicher
Höhe und gleichem Abstande am Rande des Scheitels entspringen.
h f l
''S ■
411 _
gebildet. Seltner bilden sich nur 2 zangenförmig gestellte Sterigmen
z. B. bei Hypochnus hisporus, Pistillaria mioans, Graterellus
cornucopioides, Glavulina, Hyporrhodius cetratus, oder 6 z. B.
hei Hypochnus coronatus, Gantharellus cibarius.
Manchmal wird das ganze Hymenium ausschliesslich aus Basidien
gebildet, in vielen Fällen aber werden sie von besonderen unfruchtbaren
Zellen unterbrochen, welche als P a r a p hy sen und als
C y s t id e n bezeichnet werden. Als P a r a p h y s e n bezeichnet man
Zellen, welche in ihrer Form den jungen Basidien ähnlich oder
gleich gestaltet sind, welche aber nie in Sterigmen auswachsen.
Sie stehen z. B. bei Goprinus in regelmässiger Anordnung zwischen
den sporenbildenden Basidien. — Unter C y s t id e n versteht man
stärkere, aus dem Hymenium vorragende, zerstreut zwischen den
Basidien oder bei den Agaricaceen mehr oder minder dicht an
der Schneide der Lamellen stehende Zellen. Sie sind von sehr
mannigfacher Grösse und Gestalt, die für die einzelnen Arten,
ja ganze Gruppen, sehr charakteristisch ist. Sehr oft ist ihre
Membran stark verdickt, ihr Scheitel abgerundet, zugespitzt oder
mit verschiedenartigen Zacken und Spitzchen besetzt. Sie finden
sich bei vielen Hypoohnaceen, Thelephoraceen, Polyporaceen
und besonders bei bestimmten Gruppen der Agaricaceen. Ueber
ihre Natur giebt ihr Auftreten bei den Hypoohnaceen den besten
Aufschluss. Hier erscheinen sie als steife Borsten zwischen den
lose nebeneinander stehenden Basidien. Bei der Auflösung
des Hyphengewirres sieht man, dass sie Enden der Hyphen-
büsehel sind, deren tiefere Zweige in Basidien auslaufen. Sie
sind gewissermassen Haarbildungen, und es stimmt zu dieser
Auffassung auch, dass ganz gleiche Gebilde in der für die Species
charakteristischen Gestalt oft am oberen Enden des Stieles und
selbst auf der Hutoberfläche Vorkommen, z. B. bei Mycena sanguinolenta
und Morasmius erythropus.
An den spitzen Enden der Sterigmen werden die Sporen
einzeln abgeschnürt und nach der Reife meist einzeln abgestossen.
Ausser der typischen Sporenbildung an Basidien ist bei einer
Anzahl von Hymenomyceten C o n i d i e n b i ld u n g bekannt. — Bei
Exobasidium, Vaccinii schnürt sich nach der Keimung der Sporen
in Wasser, wenn der Keimschlauch nicht sofort in die geeignete
Nährpflanze eindringen kann, am Ende des kurzen Keimschlauchs
eine spindelförmige Conidie ab, welche sofort am Ende wieder
anssprosst. Bei geeigneter Ernährung in Nährlösung kann dieses
hefeartige Wachsthum lange Zeit förtgeführt werden. — Eine
l .V l
i i