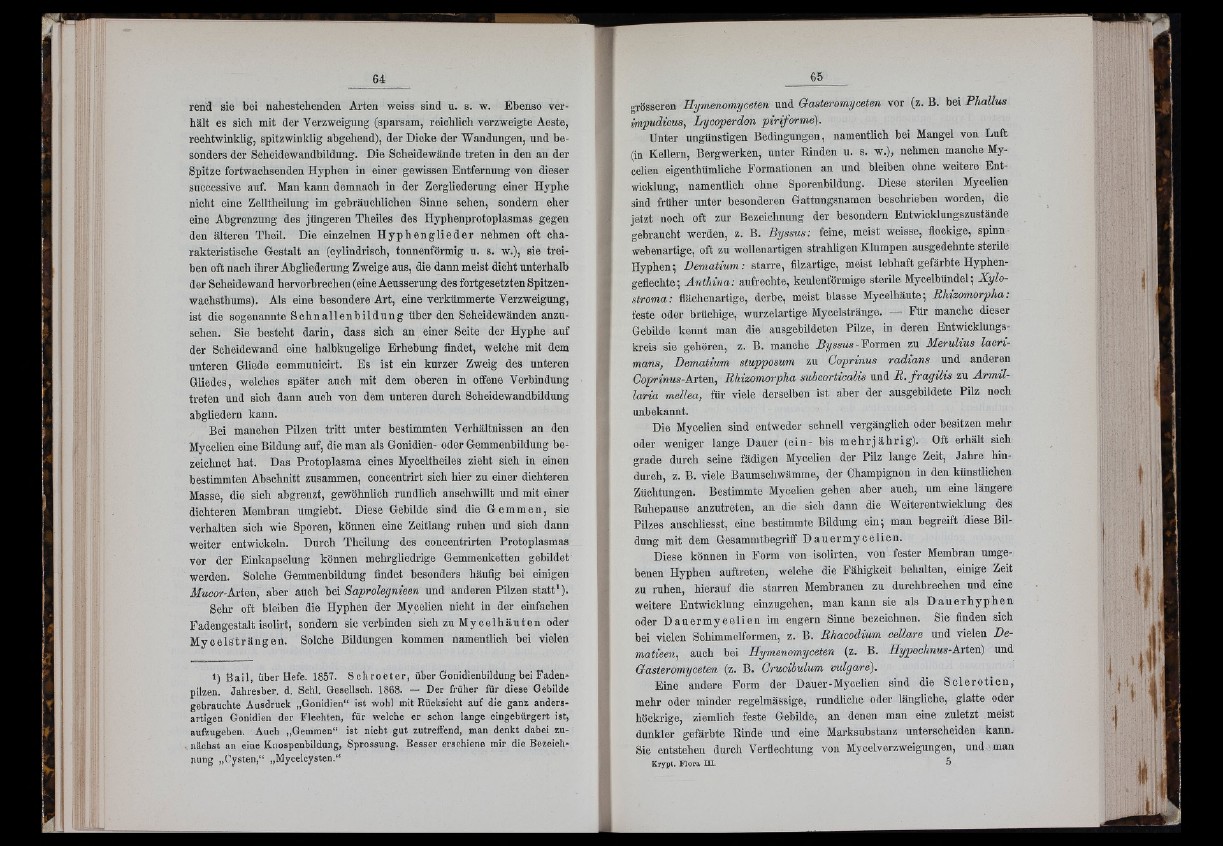
rend sie bei nahestehenden Arten weiss sind u. s. w. Ebenso verhält
es sich mit der Verzweigung (sparsam, reichlich verzweigte Aeste,
rechtwinklig, spitzwinklig ahgehend), der Dicke der Wandungen, und besonders
der Scheidewandhildung. Die Scheidewände treten in den an der
Spitze fortwaohsenden Hyphen in einer gewissen Entfernung von dieser
sucoessive auf. Man kann demnach in der Zergliederung einer Hyphe
nicht eine Zelltheilung im gebräuchlichen Sinne sehen, sondern eher
eine Abgrenzung des jüngeren Theiles des Hyphenprotoplasmas gegen
den älteren Theil. Die einzelnen Hyphengl iede r nehmen oft charakteristische
Gestalt an (cylindrisch, tonnenförmig u. s. w.), sie treiben
oft nach ihrer Ahgliederung Zweige aus, die dann meist dicht unterhalb
der Scheidewand hervorbrechen (eine Aeusserung des fortgesetzten Spitzenwachsthums).
Als eine besondere Art, eine verkümmerte Verzweigung,
ist die sogenannte Schnal lenbi ldung über den Scheidewänden anzusehen.
Sie besteht darin, dass sich an einer Seite der Hyphe auf
der Scheidewand eine halbkugelige Erhebung findet, welche mit dem
unteren Gliede communicirt. Es ist ein kurzer Zweig des unteren
Gliedes, welches später auch mit dem oberen in offene Verbindung
treten und sich dann auch von dem unteren durch Scheidewandhildung
abgliedern kann.
Bei manchen Pilzen tritt unter bestimmten Verhältnissen an den
Mycelien eine Bildung auf, die man als Gonidien- oder Gemmenbitdung bezeichnet
hat. Das Protoplasma eines Myceltheiles zieht sich in einen
bestimmten Abschnitt zusammen, coneentrirt sich hier zu einer dichteren
Masse, die sich abgrenzt, gewöhnlich rundlich anschwillt und mit einer
dichteren Membran umgiebt. Diese Gebilde sind die Gemmen, sie
verhalten sich wie Sporen, können eine Zeitlang ruhen und sich dann
weiter entwickeln. Durch Theilung des concentrirten Protoplasmas
vor der Einkapselung können mehrgliedrige Gemmenketten gebildet
werden. Solche Gemmenbildung findet besonders häufig bei einigen
ifwcor-Arten, aber auch hA Saprolegnieen und anderen Pilzen statt').
Sehr oft bleiben die Hyphen der Mycelien nicht in der einfachen
Padengestalt isolirt, sondern sie verbinden sich zu Mycelhäuten oder
Mycelsträngen. Solche Bildungen kommen namentlich bei vielen
1) B a i l , über Hefe. 1857. S c h r o e t e r , über Gonidienbildung bei Faden*
pilzen. Jahresbe r. d, Schl. Gesellsch. 1868. — Der früher für diese Gebilde
gebrauchte Ausdruck „Gonidien“ is t wohl mit Rücksicht au f die ganz andersartigen
Gonidien der Flechten, für welche e r schon lange e ingebürgert ist,
aufzugeben. Auch „Gemmen“ ist nicht gut zutreffend, man denkt dabei zunächst
an eine Knospenbildung, Sprossung. Besser erschiene mir die Bezeichnung
„Cysten,“ „Mycelcysten.“
grösseren Hymenomyceten und Gasteromyceten vor (z. B. bei Phallus
impudicus, Lycoperdon piriforme).
Unter ungünstigen Bedingungen, namentlich hei Mangel von Luft
(in Kellern, Bergwerken, unter Rinden u. s. w.), nehmen manche Mycelien
eigenthümliche Formationen an und bleiben ohne weitere Entwicklung,
namentlich ohne Sporenbildung. Diese sterilen Mycelien
sind früher unter besonderen Gattungsnamen beschrieben worden, die
jetzt noch oft zur Bezeichnung der besondern Entwicklungszustände
gebraucht werden, z. B. Byssus: feine, meist weisse, flockige, spinn
wehenartige, oft zu wollenartigen strahligen Klumpen ausgedehnte sterile
Hyphen; Dematium: starre, fllzartige, meist lebhaft gefärbte Hyphengeflechte;
Änthina: aufrechte, keulenförmige sterile Mycelbündel; Xylo-
stroma: flächenartige, derbe, meist blasse Myeelhäute; Bhizo-morpha:
feste oder brüchige, wurzelartige Mycelstränge. — Für manche dieser
Gebilde kennt man die ansgebildeten Pilze, in deren Entwicklungskreis
sie gehören, z. B. manche Byssus-Formm zu Merulius lacrimans,
Dematium stupposum zu Goprinus radians und anderen
Goprinus-Axtea, Bhizomorpha subcorticalis und B .fra g ilis zu Armillaria
mellea, für viele derselben ist aber der ausgebildete Pilz noch
unbekannt.
Die Mycelien sind entweder schnell vergänglich oder besitzen mehr
oder weniger lange Dauer (ein- bis mehrjährig) . Oft erhält sich
grade durch seine fädigen Mycelien der Pilz lange Zeit, Jahre hindurch,
z. B. viele Baumschwämme, der Champignon in den künstlichen
Züchtungen. Bestimmte Mycelien gehen aber auch, um eine längere
Ruhepause anzutreten, an die sich dann die Weiterentwicklung des
Pilzes anschliesst, eine bestimmte Bildung ein; man begreift diese Bildung
mit dem Gesammtbegriff Dauermycel i e n .
Diese können in Form von isolirten, von fester Membran umgebenen
Hyphen auftreten, welche die Fähigkeit behalten, einige Zeit
zu ruhen, hierauf die starren Membranen zu durchbrechen und eine
weitere Entwicklung einzugehen, man kann sie als Daue rhyphen
oder Dauermycel ien im engern Sinne bezeichnen. Sie finden sich
bei vielen Schimmelformen, z. B. Bhacodium cellare und vielen De-
matieen, auch bei Hymenomyceten (z. B. HypochnMS-kxt&a) und
Gasteromyceten (z. B. Grucihulwm vulgare).
Eine andere Form der Dauer-Mycelien sind die Sclerot i e n ,
mehr oder minder regelmässige, rundliche oder längliche, glatte oder
höokrige, ziemlich feste Gebilde, an denen man eine zuletzt .meist
dunkler gefärbte Rinde nnd eine Marksubstanz unterscheiden kann.
Sie entstehen durch Vei-flechtung von Mycelverzweigungen, und man
Krypt. Flora III. 5
“ 1: ,
■'VI
*