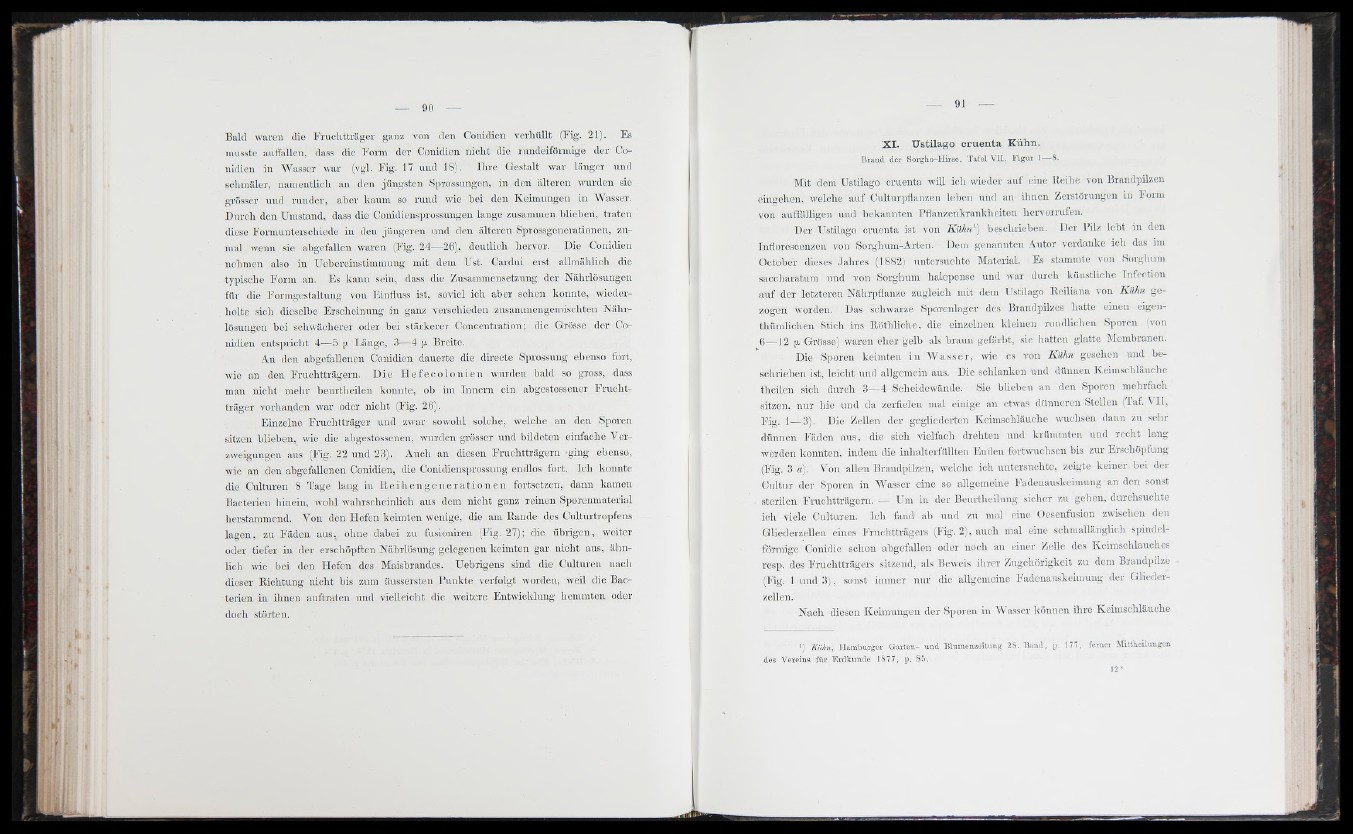
f
) *
i .
i.v»
T .
Biüd waren die Fruclitträgcr ganz von den Conidien verhüllt (Fig. 21). Es
musste auffallcn. dass die Form der Conidien nicht die rundeiförmige der Conidien
in AVasser war (vgl. F'ig. 17 und IS). Ihre Gestalt war länger und
schmäler, namentlich an den jüngsten Sprossungen, in den älteren wurden sie
grösser und runder, aber kaum so rund Avic bei den Keimungen in AA'asser.
Durch den Umstand, dass die Conidiensprossungen lange zusamnien blieben, traten
diese F'onininterschiede in den jüngeren und den älteren Sprossgenerationeii, zumal
Avenn sie abgefallen waren (F’ig. 24-—■26), deutlich hervor. Die Conidien
nehmen also in Uebereinstimmung mit dem Ust. Cardui erst allmählich die
typische Form an. Es kann sein, dass die Zusainmonsctzung der Nährlösungen
für die F'ormgestaltung von F'inffuss ist, soviel ich aber sehen konnte, Avicder-
holte sich dieselbe Erscheinung in ganz verschieden zusammengcmisclitcn Nährlösungen
bei schAvächcrer oder bei stärkerer Coneentration; die Grösse der Conidien
entspricht 4— 5 g Klnge, 3—4 g Breite.
An den abgefallenen Conidien dauerte die directe Sprossung ebenso fort,
Avie an den Fruchtträgern. D ie I l e f e c o l o n i e n wurden bald so gross, dass
man nicht mehr beurtlieilen konnte, ob im Innern ein abgestosscner Fruchtträger
vorhanden Avar oder nicht (Fig. 26).
Finzelne F'ruchtträger und ZAvar soAvolil solche, Avelclic an den Sporen
sitzen blieben. Avie die abgestossenen, AA-urdcn grösser und bildeten einfache VerzAveigungen
aus (Fig. 22 und 23). Auch an diesen Fruchtträgern ging ebenso,
Avie an den abgcfallenen Conidien, die Conidiensprossnng endlos fort. Ich konnte
die Cultnren S Tage lang in l i e i h e n g e n e r a t i o i i e n fortsetzen, dann kamen
Bacterien hinein, wohl Avahrscheinlich aus dem nicht ganz reinen Sporenmaterial
herstamiiiend. A'on den Hefen keimten wenige, die am Bande des Cultnrtropfens
lagen, zu F'äden aus, ohne dabei zn fusioniren (F'ig. 27); die übrigen, weiter
oder tiefer in der erschöpften Nährlösung gelegenen keimten gar nicht aus, ähnlich
Avic bei den Hefen des Mai.sbrandes. Uebrigens sind die Culturen nach
dieser Richtung nicht bis zum änsscrsten Funkte verfolgt Avorden, avcü die Bacterien
in ihnen auftraten und vielleicht die Aveitere EntAvicklung hemmten oder
doch störten.
XI. Ustilago c ru e n ta Kühn.
B r a n d d e r S o r g h o -H i r s e , T a f e l V I I , F ig u r 1— 8
A lit d em Ü s tila g o c ru e n ta Avill ic h Avieder a u f e in e R e ih e v o n B ra n d p ilz e n
c in g e h e ii, avcIcIic a u f C u ltu rp f la n z e n l e b e n u n d a n ih n e n Z e r s tö ru n g e n in F o rm
v o n a u ff ä llig e n u n d b e k a n n te n F f ia n z c n k r a n k h e ite n h e rv o iT u fe n .
Der Ustilago cruenta ist von KühiV) beschrieben. Der Pilz lebt in den
Infiorescenzen von Sorglium-Arteii. Dem genannten Autor verdanke ich das im
Octobor dieses Jahres (1882) untersuchte Alaterial. Es stammte von Sorghum
saccharatum und von Sorghum halepenso und Avar durch künstliche Infection
anf der letzteren Nährpilanze zugleich mit dem Ustilago Reiliana von Kiik» gezogen
AVorden. Das schwarze Sporenlagcr des Brandpilzes hatte einen eigen-
thümliclicn Stich ins Rötliliclie, die einzelnen kleinen rundlichen Sporen von
(5— ] 2 ¡X Grösse't waren eher gelb als braun gefärbt, sie hatten glatte Alembranen.
Die Sporen keimten in AVasser, wie cs von Kühn gesehen und beschrieben
ist, leicht und allgemein aus. Die schlanken und dünnen Keimschläuclie
theilen sich durch 3—4 ScheideAvände. Sie bliehen an den Sporen mehrfach
sitzen, nur hie und da zerfielen mal einige an etAA'as dünneren Stellen (Taf. \H ,
Fig. 1—3). Die Zellen der gegliederten Keimscliläuclie wuchsen dann zu sehr
dünnen Fäden aus, dio sich vielfach drehten und krümmten und recht lang
Averden konnten, indem die inlialterfüllten Enden fortAvuchsen bis zur Erschöpfung
(Fig. 3 a). Von allen Brandpilzen, Avelche ich untersuchte, zeigte keiner hei der
Cultnr der Sporen in AA'asser eine so allgemeine F'adenauskeimung an den sonst
sterilen Fruchtträgcrn. — l'm in der Beurtheilung sicher zu gehen, durchsuchte
ich viele Culturen. Ich ffind ab und zu mal eine Ocsenfusion zwischen den
GliederzcHen eines Fruclitträgers iFig. 2), aucli mal eine schmallänglich spindelförmige
Conidie schon abgefallen oder noch an einer Zelle des Keimschlauches
resp. des Fruchtträgers sitzend, als BeAveis ihrer Zugehörigkeit zu dem Brandpilze
(Fig. 1 und 3) . sonst immer nur die allgemeine Fadcnaiiskcimuug der Glieder-
zcilen.
Nach diesen Keimungen der Sporen in AA'asser können ihre Keimschläuche
( K iiM i. Ilambur^^er G u r t e n - u n d B lu in e n z e it u n g 2 8 . B u n d , p . 17
d e s V e r e in s fü r E r d k u n d e 1 8 7 7 , p . 8 5 ,
f e r n e r M it th e ilu n g e n