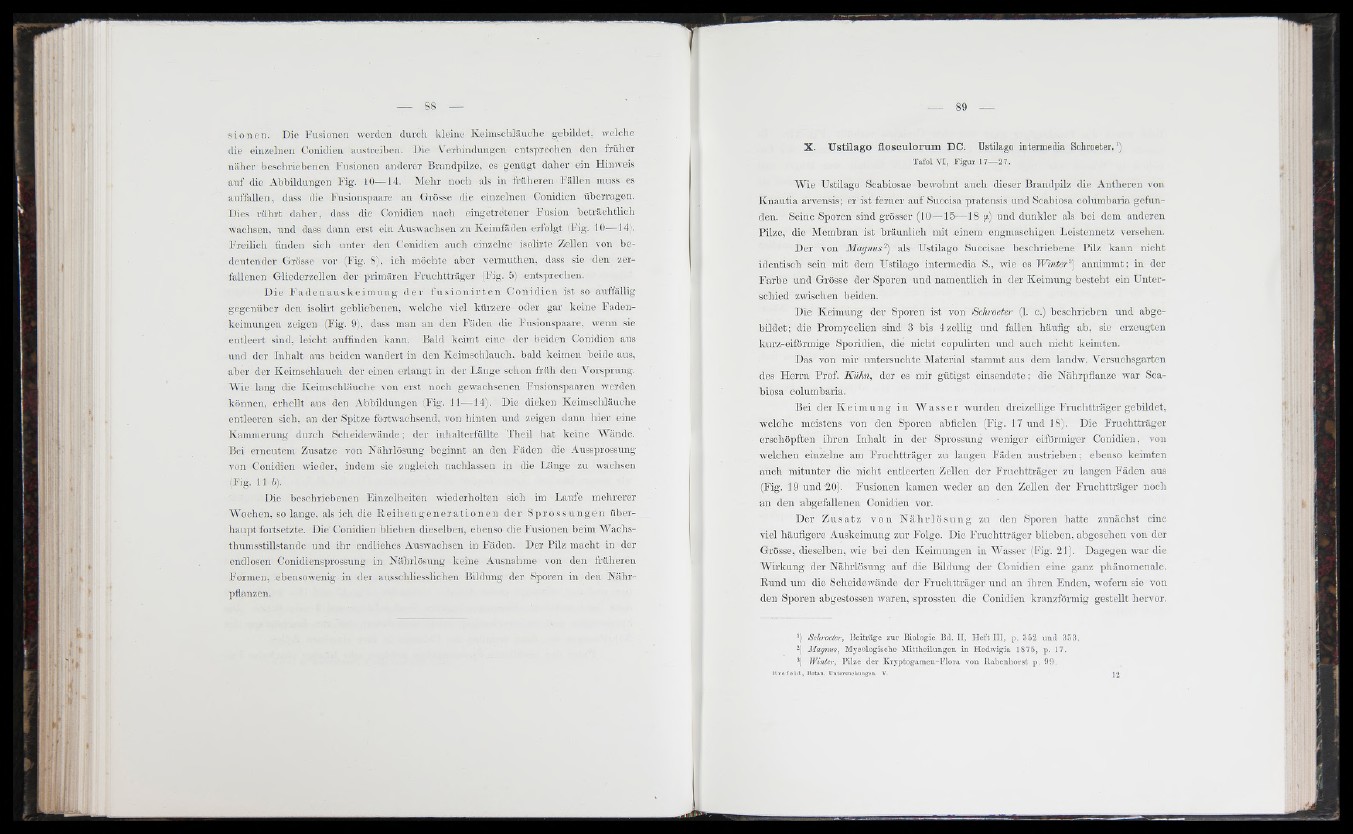
s io n c ii. Die Fusionen werden durcli kleine Keimschläuche gebildet, welche
die einzelnen Conidien austreiben. Die Verbindungen entsprechen den frülier
nälier beschriebenen Fusionen anderer Brandiiilze, cs genügt daher ein Hinweis
auf dio Ahhildungcn Fig. Kl— 14. Alehr noch als in früheren Fällen muss es
auffallcn. dass die Fusionspaare an Grösse die einzelnen Conidien überragen.
Dies rührt daher, dass die ('onidien nach eingetretener Fusion hcträclitlich
wachsen, und dass dann erst ein Auswachsen zu Keimfäden erfolgt Fig. lü— 14;.
Freilicli iinden sich unter den Conidien aucli einzelne isolirte Zellen von bedeutender
(jrösse vor 'Fig. S'. icli möchte aber vermuthen. dass sie den zerfallenen
Gliederzellcn der primären Fruchtträger (Fig. 5’: entsprechen.
Die F a d e n a n s k c im u n g d e r f u s i o n i r t e n ( 'o n id ie n ist so auffällig
gegenüber den isolirt gebliebenen, Avelche viel kürzere oder gar keine Fadcn-
kcinningen zeigen (Fig. 9', dass man an den Fäden die Fnsionspaare. wenn sie
entleert sind, loicht aufiinden kann. Bald keimt eine der beiden Conidien aus
und der Inhalt aus beiden wandert in den Keimschlauch, bald keimen beide aus,
aber der Keimschlauch der einen erlangt in der l.ängc schon früh den A'orsprung.
AVie lang die Keimschläuche von erst noch gewachsenen Fusionspaaren werden
können, erhellt aus den Abbildungen Fig. 11 — 14). Die dicken Keimscliläuclie
entleeren .sich, an der Spitze fortwachsend, von hinten und zeigen dann liier eine
Kammerung durch Scheidewände: der inhaltcrfüllte Tlieil hat keine AATinde.
Bei erneutem Zusatze von Nährlösung beginnt an den Fäden die Aussprossung
von Conidien wieder, indem sie zugleich nachlassen in die I-änge zu ivachsen
■Fig. II h).
Die beschriebenen Einzelheiten wiederholten sicli im Laufe molirerer
AVochen. so lange, als ich die K e ih e n g e n c r a t io n e n d e r S p r o s s u n g e n überhaupt
fortsetzte. Die ('onidien bliehen dieselben, ebenso die Fusionen beim AAachs-
thumsstillstande nnd ihr endliches Auswachsen in Fäden. Der Filz macht in der
endlosen Conidicnsprossung in Nährlösung keine Ausnahme von den früheren
Formen, ebensowenig in der ausscliliesslichen Bildung der Sporen in den Nähr-
]itianzen.
X. Ustilago flosculorum DC. üstilago intermedia Schroeter.’}
T a f e l V I , F ig u r 1 7— 2 7 .
AVie Ustilago Scabiosae bcAVohnt aucli dieser Brandpilz die Antheren von
Knautia arvensis; er ist ferner auf Succisa pratensis und Scabiosa columbaria gefunden.
Seine Sporen sind grösser (10 —15— 18 g) und dunkler als bei dem anderen
Pilze, die Alembran ist bräunlich mit einem engmaschigen Lcistennetz verseilen.
Der von Magnus'^) als Ustilago Succisae beschriebene Pilz kann nicht
identisch sein mit dem Ustilago intermedia S., wie cs Winter'*) annimmt; in der
Farbe und Grösse der Sporen und namentlich in der Keimung besteht ein Unterschied
zwischen beiden.
Die Keimung der Sporen ist von Schroeter (1. c.) beschrieben und abgebildet;
die Promycelien sind 3 bis 4 zellig und fallen häufig ab, sie erzeugten
kurz-eiförmige Sporidien, die nicht copulirten und auch nicht keimten.
Das von mir untersuchte Alaterial stammt aus dem landw. Versnchsgarten
des Herrn Prof. Kühn, der es mir gütigst einsendete; die Nährpfianze war Scabiosa
columbaria.
Bei der K e im u n g in AA'asser wurden dreizellige Fruchtträger gebildet,
welclie meistens von den Sporen abfielen (Fig. 17 und 18). Die Fruchtträger
erschöpften ihren Inlialt in der Sprossung weniger eiförmiger Conidien, von
welchen einzelne am Fruchtträger zu langen Fäden austrieben; ebenso keimten
auch mitunter die nicht entleerten Zollen der Fruchtträger zu langen Fäden ans
(F'ig. 19 und 20). F’usionen kamen weder an den Zellen der Fruchtträger noch
an den abgcfallenen Conidien vor.
Der Z u s a tz v o n N ä h iT ö s u n g zu den Sporen hatte zunächst eine
viel häufigere Auskeimung zur Folge. Die Fruchtträger blichen, abgesehen von der
Grosse, dieselben, wie bei den Keimungen in AA'asser (Fig. 21). Dagegen ivar die
AVirkung der Nährlösung auf die Bildung der Conidien eine ganz phänomenale.
Rund um die Scheidewände der F'ruchtträger und an ihren Enden, Avofcrn sie von
den Sporen ahgestossen waren, sprossten die Conidien kranzförmig gestellt hervor.
.•f
’) S c h r o e te r , B e it r ä g e zu r B i o lo g ie B d . I I , H e f t I I I , p . 3 5 2 u n d 3 5 3 .
2) M a g n u s , M y c o lo g is c h e M it t h e ilu n g e n in H e d w ig ia 1 8 7 5 , p . 1 7 .
3) W in te r , F ilz e d e r K r y p t o g am e n -F lo r a v o n R a b e n h o r s t p .
• e f e li l. Hotan. Uiitovsuuhuiigen. V.