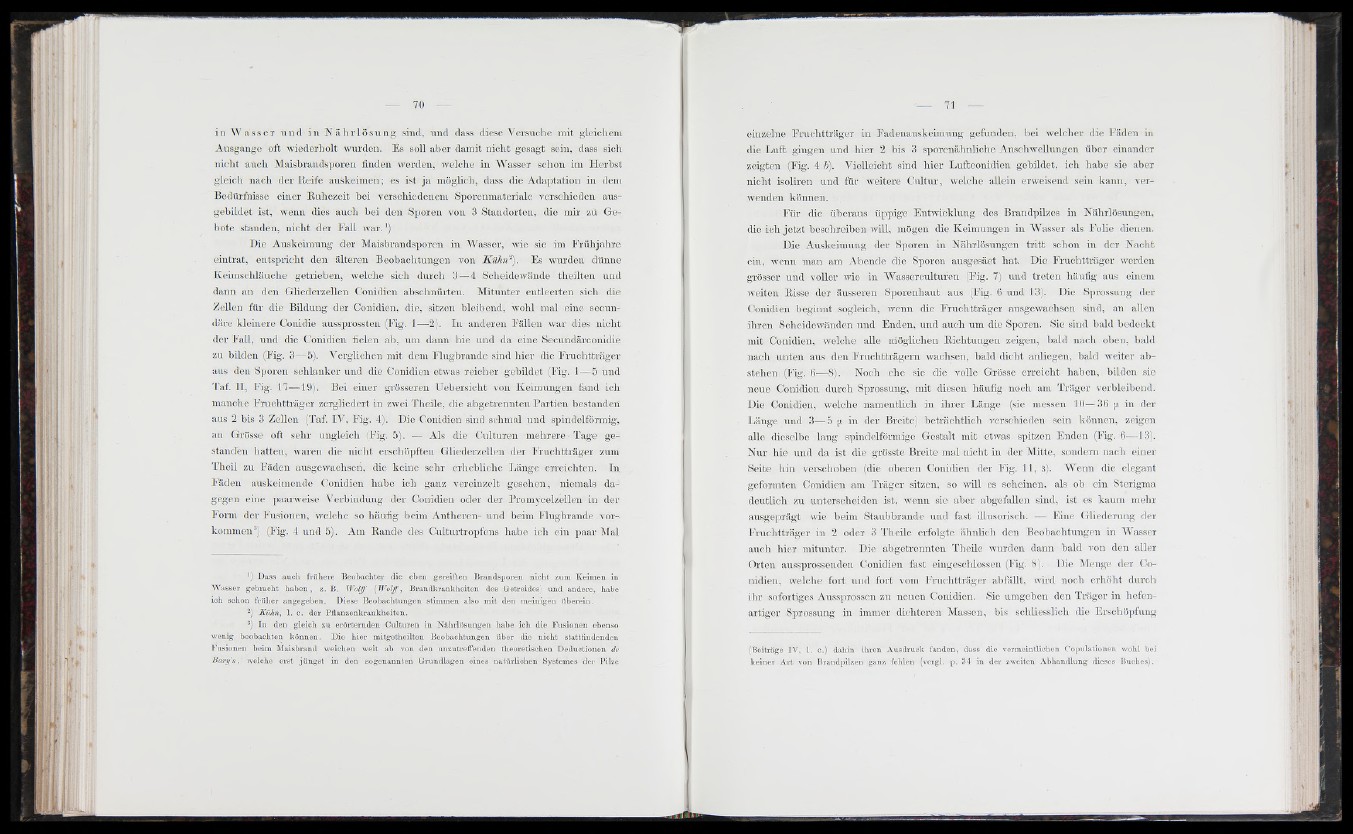
: I
in XVasser n n d in N ä h r l ö s u n g sind, und dass diese Versuche mit gleichem
Ausgange ui't wiederholt wurden. Es soll aber damit nicht gesagt sein, dass sieh
nicht auch Alaisbrandsporen finden werden, welclie in AVasser schon im Herbst
gleich nach der Keife auskeimen; es ist ja möglich, dass die Adaptation in dem
Bedürfnisse einer Iluhczeit bei verschiedenem S])orenmateriale verschieden ausgebildet
ist, wenn dies aucli bei den Sporen von 3 Standorten, die mir zn (Gebote
standen, nicht der Fall war.')
Die Auskeimung der Alaishraiidsporen iu AA'asser, wie sie im Frühjahre
eintrat, entspricht den älteren Beobachtungen von IXllkP). Es wurden düinio
Keimschläuche getrieben, welche sich durch 3 — 4 Scheidewände theilten und
dann an den Gliederzellcn ('onidien abschnürten. Alituiiter entleerten sich die
Zellen für die Bildung der Conidien. die, sitzen bleibend, wohl mal eine seciiii-
däre kleinere Conidie aussprossten {Fig. 1—2'. ln anderen Fällen war dies nicht
der Fall, und die Conidien fielen ab. um dann hic und da eine Secundärconidie
zu bilden {Fig. 3—5). A'erglichen mit dem Flugbrande sind hier die Fruchtträger
aus den Sporen schlanker nnd die C’onidien etwas reicher gebildet (Fig. 1—5 und
Taf. 11, Fig. 17— 19;. Bei einer grösseren Uebersicht von Keimungen fand ich
manche Fruchtträger zergliedert in zwei 'i'heile, die abgetrennteii Partien bestanden
aus 2 his 3 Zellen ;Taf. lA'. Fig. 4). Die Conidien sind sdmiai und spindelförmig,
an Grösse oft sehr ungleich Fig. 5). — Als die Culturen mehrere Tage ge-
.standen hatten, waren die nicht erschöpften Gliederzelion der F'ruchtträger zum
'L'heil zu Fäden ausgewachsen, die keine sehr erhebliche Länge erreichten, ln
Fäden anskeimende ( ’onidien habe ich ganz vereinzelt gesehen, niemals dagegen
eine paarweise A’erbindung der Conidien oder der Promycelzellcn in der
l'orm der Fusionen, welche so häutig beim Antheren- und beim Flugbrande Vorkommen'*;
Fig. 4 und 5). Am Rande des (¡ulturtropfens habe ich ein i>aar Mal
') D a s s a u c li f r ü h e r e B e o b a c h t e r d i e e b e n g e r e if t e n B r a n d sp o r e n n i c h t z um K e im e n in
W a s s e r g e b r a c h t h a b e n , z . B . W o iß ' [W u lf f , B r a n d k r a u k h e it e n d e s G e t r e id e s u n d a n d e r e , h a b e
ie h s c h o n f rü h e r a n g e g e b e n . D i e s e B e o b a c h t u n g e n s t im m e n a ls o m it d e n m e in ig e n ü b e r e in .
2^ K ü h n , 1. C. d e r P f la n z e n k r a n k h e it e n .
3) I n d e n g le ic h z u e r ö r te r n d e n C u ltu r e n in N ä h r lö s u n g e n h a b e i c h d ie l'u s io n e n e b e n s o
w e n ig b e o b a c h t e n k ö n n e n . D i e h i e r m it g e t h e ilt e n B e o b a c h tu n g e n ü b e r d ie n i c h t s ta tt fh id e n d c n
F u s io n e n b e im M a isb r a n d w e i c h e n w e i t ab v o n d e n u n z u t r e ff e n d e n th e o r e t i s c h e n D e d u c t io n e n d t
B l u f f s , w e lc h e e r s t j ü n g s t in d e n s o g e n a u u f e n G r u n d la g e n e in e s n a lü r lic lu n i ö y s t em e s d e r P ilz e
t ! •
ii:
einzelne Fruchtträger in Fadonanskcimung gefunden, bei welcher die Fäden in
die Luft gingen und hier 2 bis 3 sporenähnliche Anschwellungen über einander
zeigten (Fig. 4 h). A^ieUeicht sind hier Luftconidien gebildet, ich habe sie aber
nicht isoliren nnd für weitere Cultnr, welche allein erweisend sein kann, verwenden
können.
Für die überaus iq)pige Entwicklung des Brandpilzcs in Nährlösungen,
die ich jetzt beschreiben will, mögen die Keimungen in AVasser als Eolie dienen.
Die Auskeimung der Sporen in Nährlösungen tritt schon in der Naclit
ein, wenn man am Abende die Sporen ausgesäet hat. Die Fruchtträgor werden
grösser und voller wie in AA^asserculturen (Fig. 7) und treten häutig aus einem
weiten Risse der äusseren S])orcnhaut aus (Fig. (> und 13). Die Sprössling der
Conidien beginnt sogleich, wenn die Fruchtträger ausgewachsen sind, an allen
ihren Scheidewänden und Enden, und auch um die Sporen. Sie sind hald bedeckt
mit Conidien, welche alle möglichen Richtungen zeigen, bald nach oben, hald
nach unten aus den Fruchtträgern wachsen, hald dicht anlicgen, bald weiter abstehen
(Fig. 6—8). Noch ehe sie die volle Grösse erreicht haben, bilden sie
neue Conidien durch Sprossung, mit diesen häufig noch am 'Träger verbleibend.
Die Conidien, welche namentlich in ihrer Tiänge (sie messen 10—30 \x in der
Länge und 3— 5 g in der Breite'^ beträchtlich verschieden sein können, zeigen
alle dieselbe lang s])indelförmige Gestalt mit etwas spitzen Fnden (Fig, B— 13).
Nur hic und da ist die grösste Breite mal nicht in der Alittc, sondern nach einer
Seite hin verschoben (die oberen Conidien der F'ig. 11, 3). AVcnn die elegant
geformten Conidien am Träger sitzen, so will cs scheinen, als ob ein Sterigma
deutlich zu unterscheiden ist. wenn sie aber abgefallcn sind, ist es kaum mehr
ausgeprägt wie heim Stauhbrande und fast illusorisch. — Eine (Tliederung der
Fruchtträger in 2 oder 3 'Theile erfolgte ähnlich den Beobachtungen in AA'asser
anch hier mitunter. Die abgetrennten 'Theile wurden dann bald von den aller
Orten aussj)rosspiideii Conidien fast eingoschlossen (Fig, 8V Die Alenge der (conidien.
welche fort und fort vom Fruchtträgor abfällt, wird noch erhöht durch
ihr sofortiges Aussprossen zu neuen Conidien. Sie umgehen den 'Träger in hefenartiger
Siu'ossung in immer dichteren Alassen, bis schliesslich die Erschöpfung
(B e itr ä g e IV . l . c .) d a h in ih r e n A u s d r u c k fa n d e n , d a s s d ie v e rm e in t lic h e n C o p u la t io n e n w o h l b e i
k e in e r A r t v o n B r a n d ]) ilz e n g a n z f e h l e n (v e r g l. p . 3 4 in d e r z w e it e n A b h a n d lu n g d i e s e s B u c h e s ) .
I : :
' ! | : ' l
■ . i t « ;
Li !
■: i
!!■
» ;
Ì