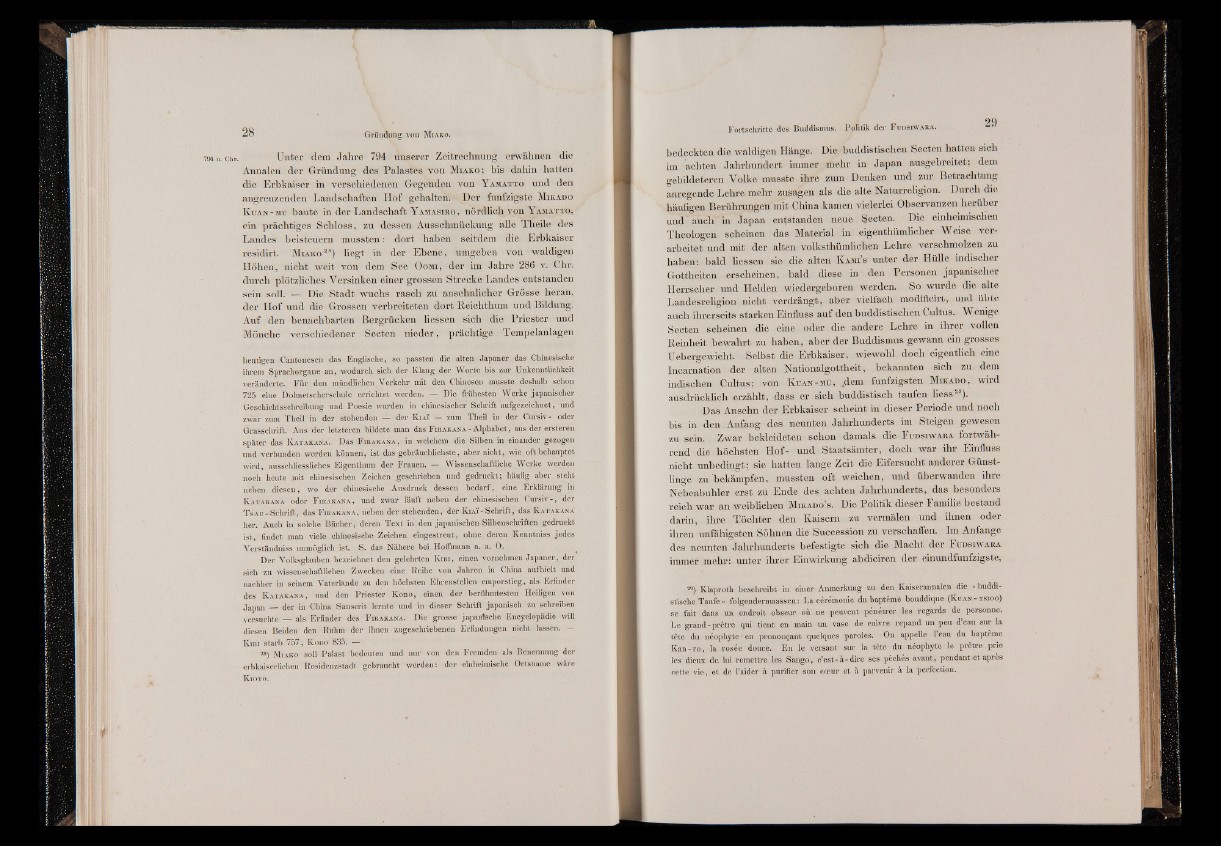
28 Gründung von M i a k o .
7M n. Ohr. Unter dem Jahre 794 unserer Zeitrechnung erwähnen die
Annalen der Gründung des Palastes von M ia k o ; bis dahin hatten
die Erbkaiser in verschiedenen Gegenden von Y am a t to und den
angrenzenden Landschaften Hof gehalten. Der fünfzigste M ik a u o
K u a n - mu baute in der Landschaft Y a m a s ir o , nördlich von Y a m a t t o ,
ein prächtiges Schloss, zu dessen Ausschmückung alle Theile des
Landes beisteuern mussten: dort haben seitdem die Erbkaiser
residirt. M ia k o 28) liegt in der Ebene, umgeben von waldigen
Höhen, nicht weit von dem See O o m i , der im Jahre 286 v. Chr.
durch plötzliches Versinken einer grossen Strecke Landes entstanden
sein soll. ■— Die Stadt wuchs rasch zu ansehnlicher Grösse heran,
der Hof und die Grossen verbreiteten dort Reichthum und Bildung.
Auf den benachbarten Bergrücken Hessen sich die Priester und
Mönche verschiedener Secten nieder, prächtige Tempelanlagen
heutigen Cantoneseu das Englische, so passten die alten Japaner das Chinesische
ihrem Sprachorgane an, wodurch sich der Klang der Worte bis zur Unkenntlichkeit
veränderte. Für den mündlichen Verkehr mit den Chinesen musste deshalb schon
725 eine Dolmetscherschule errichtet werden. — Die frühesten Werke japanischer
Geschichtsschreibung und Poesie wurden in chinesischer Schrift aufgezeichnet, und
zwar zum Theil in der stehenden'^- der K i a i — zum Theil in der Cursiv- oder
Grasschrift. Ans der letzteren bildete man das F i r a k a n a - Alphabet, aus der erstereu
später das K a t a k a n a . Das F i b a k a n a , in welchem die Silben in einander gezogen
und verbunden werden können, ist das gebräuchlichste, aber nicht, wie oft behauptet
wird, ausschliessliches Eigenthum der Frauen. — Wissenschaftliche Werke werden
noch heute mit chinesischen Zeichen geschrieben und gedruckt; häufig aber steht
neben diesen, wo der chinesische Ausdruck dessen bedarf, eine Erklärung in
K a t a k a n a oder F i b a k a n a , und zwar läuft neben der chinesischen Cursiv - , der
TsAD-Schrift, das F i b a k a n a , neben der stehenden, der K i a i -Schrift, das K a t a k a n a
her. Auch in solche Bücher, deren Text in den japanischen Silbenschriften gedruckt
ist, findet man viele chinesische Zeichen eingestreut, ohne deren Kenntniss jedes
Verständniss unmöglich ist. S. das Nähere bei Hoffniann a. a. 0.
Der Volksglauben bezeichnet den gelehrten K ibt, einen vornehmen Japaner, der
sich zu wissenschaftlichen Zwecken eine Reihe von Jahren in China aufhielt und
nachher in seinem Vaterlande zu den höchsten Ehrenstellen emporstieg, als Erfinder
des K a t a k a n a , und den Priester K o b o , einen der berühmtesten Heiligen von
Japan — der in China Sanscrit lernte und in dieser Schrift japanisch zu schreiben
versuchte — als Erfinder des F i b a k a n a . Die grosse japanische Encyclopädie will
diesen Beiden den Ruhm der ihnen • zugeschriebenen Erfindungen nicht lassen. -
K i b i starb 757, K o b o 835. —
®) M i a k o soll Palast bedeuten und nur von den Fremden als Benennung der
erbkaiserlichen Residenzstadt gebraucht werden: der einheimische Ortsname wäre
K i o t o .
l
Fortschritte des Buddismus. Politik der F u d s iw a r a .
bedeckten die waldigen Hänge. Die buddistischen Secten hatten sich
im achten Jahrhundert immer mehr in Japan ausgebreitet; dem
gebildeteren Volke musste ihre zum Denken und zur Betrachtung
anregende Lehre mehr Zusagen als die alte NaturreHgion. Durch die
häufigen Berührungen mit China kamen vielerlei Observanzen herüber
und auch in Japan entstanden neue Secten. Die einheimischen
Theologen scheinen das Material in eigenthümhcher Weise verarbeitet
und mit der alten volksthümlichen Lehre verschmolzen zu
haben: bald Hessen sie die alten K am i’s unter der Hülle indischer
Gottheiten erscheinen, bald diese in den Personen japanischer
Herrscher und Helden wiedergeboren werden. So wurde die alte
Landesreligion nicht verdrängt, aber vielfach modificirt, und übte
auch ihrerseits starken Einfluss auf den buddistischen Cultus. Wenige
Secten scheinen die eine oder die andere Lehre in ihrer vollen
Reinheit bewahrt zu haben, aber der Buddismus gewann ein grosses
Uebergewicht. Selbst die Erbkaiser, wiewohl doch eigenthch eine
Incarnation der alten Nationalgottheit, bekannten sich zu dem
indischen Cultus; von K u a n - m u , .dem fünfzigsten M ik a d o , wird
ausdrückhch erzählt, dass er sich buddistisch taufen Hess29).
Das Ansehn der Erbkaiser scheint in dieser Periode und noch
bis in den A n f a n g des neunten Jahrhunderts im Steigen gewesen
zu sein. Zwar bekleideten schon damals die F u d s iw a r a fortwährend
die höchsten Hof- und Staatsämter, doch war ihr Einfluss
nicht unbedingt; sie hatten lange Zeit die Eifersucht anderer Günstlinge
zu bekämpfen, mussten oft weichen, und überwanden ihre
Nebenbuhler erst zu Ende des achten Jahrhunderts, das besonders
reich war an weibHchen M ik a d o ’s . Die Politik dieser Familie bestand
darin, ihre Töchter den Kaisern zu vermalen und ihnen oder
ihren unfähigsten Söhnen die Succession zu verschaffen. Im Anfänge
des neunten Jahrhunderts befestigte sich die Macht der F u d s iw a r a
immer mehr: unter ihrer Einwirkung abdiciren der einundfunfzigste,
29) Klaproth beschreibt in einer Anmerkung zu den Kaiserannalen die »buddi-
stische Taufe « folgendermaassen : La cérémonie du baptême bouddique (K u a n - t s io o )
se fait dans un endroit obscur où ne peuvent pénétrer les regards de personne.
Le grand-prêtre qui . tient en main un vase de cuivre répand un peu d’eau sur la
tête du néophyte en prononçant quelques paroles. On appelle 1 eau du baptême
Kan - r o , la rosée douce. En le versant sur la tête du néophyte le pretre prie
les dieux de lui remettre les Sango, c’est-à-dire ses peches avant, pendant et après
cette ' vie, et. de l’aider à purifier son coeur et à parvenir à la perfection.