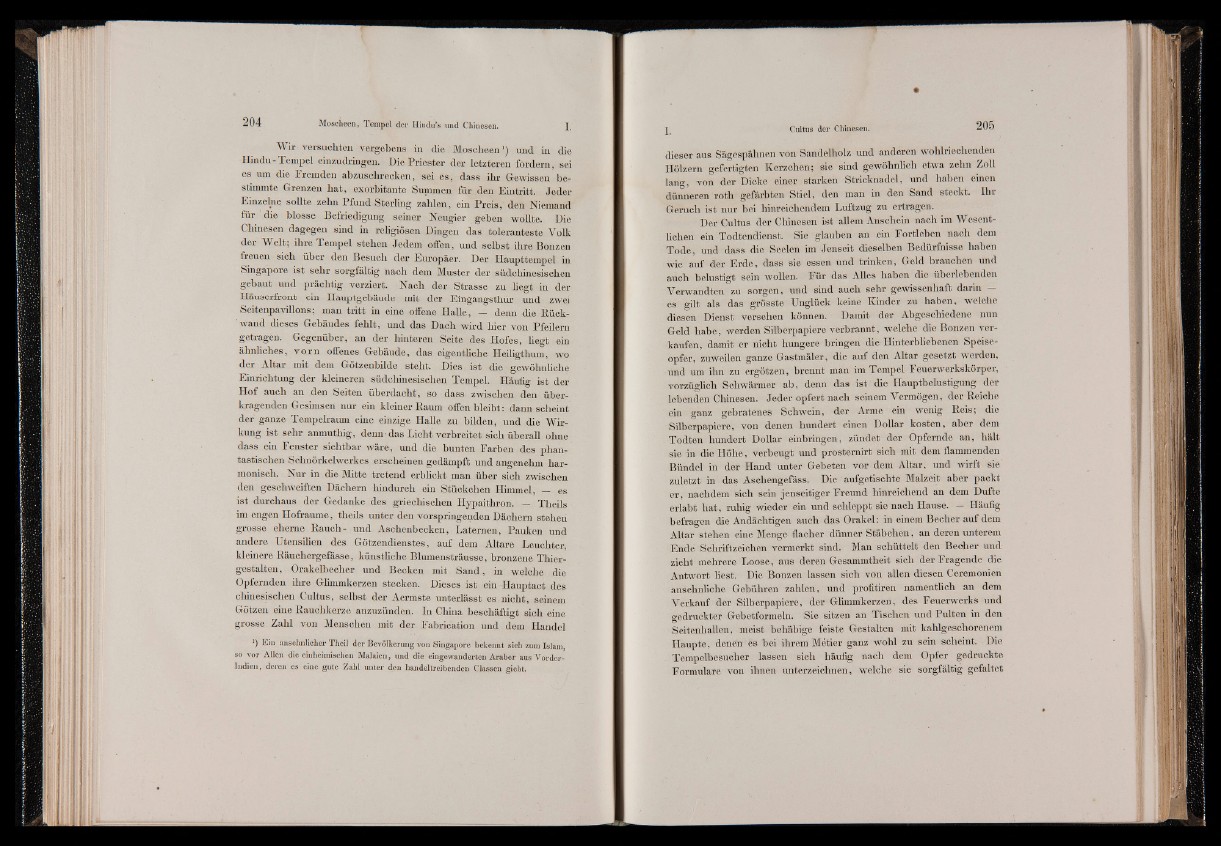
Wir versuchten vergebens in die Moscheen1) und in die
Hindu-Tempel einzudringen. Die Priester der letzteren fördern, sei
es um die Fremden abzuschrecken, sei es, dass ihr Gewissen bestimmte
Grenzen hat, exorbitante Summen für den Eintritt. Jeder
Einzelne sollte zehn Pfund Sterling zahlen, ein Preis, den Niemand
für die blosse Befriedigung seiner Neugier geben wollte. Die
Chinesen dagegen sind in religiösen Dingen das toleranteste Volk
der Welt; ihre Tempel stehen Jedem offen, und selbst ihre Bonzen
freuen sich über den Besuch der Europäer. Der Plaupttempel in
Singapore ist sehr sorgfältig nach dem Muster der südchinesischen
gebaut und prächtig verziert. Nach der Strasse zu hegt in der
Häuserfront ein Plauptgebäude mit der Eingangsthüx und zwei
Seitenpavillons; man tritt in eine offene Halle, — denn die Rückwand
dieses Gebäudes fehlt, und das Dach wird hier von Pfeilern
getragen. Gegenüber, an der hinteren Seite des Hofes, hegt ein
ähnliches, v o rn offenes Gebäude, das eigenthche Heiligthum, wo
der Altar mit dem Götzenbilde steht. Dies ist die gewöhnhche
Einrichtung der kleineren südchinesischen Tempel, Häufig ist der
Hof auch an den Seiten überdacht, so dass zwischen den überkragenden
Gesimsen nur ein kleiner Raum offen bleibt: dann scheint
der ganze Tempelraum eine einzige Halle zu bilden, und die Wirkung
ist sehr anmuthig, denn das Licht verbreitet sich überall ohne
dass ein Fenster sichtbar wäre, und die bunten Farben des phantastischen
Sehnörkelwerkes erscheinen gedämpft und angenehm harmonisch.
Nur in die Mitte tretend erbhckt man über sich zwischen
den geschweiften Dächern hindurch ein Stückchen H im m e l , e s
ist durchaus der Gedanke des griechischen Hypaithron. — Theils
im engen Hofraume, theils unter den vorspringenden Dächern stehen
grosse eherne Rauch- und Aschenbecken, Laternen, Pauken und
andere Utensilien des Götzendienstes, auf dem Altäre Leuchter,
kleinere Räuchergefässe, künstliche Blumensträusse, bronzene Thiergestalten,
Orakelbecher und Becken mit Sand, in welche die
Opfernden ihre Glimmkerzen stecken. Dieses ist <ein Hauptact des
chinesischen Cultus, selbst der Aermste unterlässt es nicht, seinem
Götzen eine Rauchkerze anzuzünden. In China beschäftigt sich eine
grosse Zahl von Menschen mit der Fabrication und dem Handel
') Ein ansehnlicher Theil der Bevölkerung von Singapore bekennt sich zum Islam,
so vor Allen die einheimischen Malaien, und die eingewanderten Araber aus Vorderindien,
deren es eine gute Zahl unter den handeltreibenden Classen giebt.
dieser aus Sägespähnen von Sandelholz und anderen wohlriechenden
Hölzern gefertigten Kerzchen; sie sind gewöhnlich etwa zehn Zoll
lang, von der Dicke einer starken Stricknadel, und haben einen
dünneren roth gefärbten Stiel, den man in den Sand steckt. Ihr
Geruch ist nur bei hinreichendem Luftzug zu ertragen.
Der Cultus der Chinesen ist allem Anschein nach im Wesentlichen
ein Todtendienst. Sie glauben an ein Fortlehen nach dem
Tode, und dass die Seelen im Jenseit dieselben Bedürfinisse haben
wie auf der Erde, dass sie essen und trinken, Geld brauchen und
auch belustigt sein wollen. Für das Alles haben die überlebenden
Verwandten zu sorgen, und sind auch sehr gewissenhaft darin
es gilt als das grösste Unglück keine Kinder zu haben, welche
diesen Dienst versehen können. Damit der Abgeschiedene nun
Geld habe, werden Silberpapiere verbrannt, welche die Bonzen verkaufen,
damit er nicht hungere bringen die Hinterbliebenen Speiseopfer,
zuweilen ganze Gastmäler, die auf den Altar gesetzt werden,
und um ihn zu ergötzen, brennt man im Tempel Feuerwerkskörper,
vorzüglich Schwärmer ab, denn das ist die Hauptbelustigung der
lebenden Chinesen. Jeder opfert nach seinem Vermögen, der Reiche
ein ganz gebratenes Schwein, der Arme ein wenig Reis; die
Silberpapiere, von denen hundert einen Dollar kosten, aber dem
Todten hundert Dollar einbringen, zündet der Opfernde an, hält
sie in die Höhe, verbeugt und prosternirt sich mit dem flammenden
Bündel in der Hand unter Gebeten vor dem Altar, und wirft sie
zuletzt in das Aschengefäss. Die aufgetischte Malzeit aber packt
er, nachdem sich sein jenseitiger Freund hinreichend an dem Dufte
erlabt hat, ruhig wieder ein und schleppt sie nach Hause. — Häufig
befragen die Andächtigen auch das Orakel: in einem Becher auf dem
Altar stehen eine Menge flacher dünner Stäbchen, an deren unterem
Ende Schriftzeichen vermerkt sind. Man schüttelt den Beoher und
zieht mehrere Loose, aus deren Gesammtheit sich der Fragende die
Antwort liest. Die Bonzen lassen sich von allen diesen Ceremonien
ansehnliche Gebühren zahlen, und profitiren namentlich an dem
Verkauf der Silberpapiere, der Glimmkerzen, des Feuerwerks und
gedruckter Gebetformeln. Sie sitzen an Tischen und Pulten in den
Seitenhallen, meist behäbige feiste Gestalten mit kahlgeschorenem
Haupte, denen es bei ihrem Métier ganz wohl zu sein scheint. Die
Tempelbesucher lassen sich häufig nach dem Opfer gedruckte
Formulare von ihnen unterzeichnen, welche sie sorgfältig gefaltet