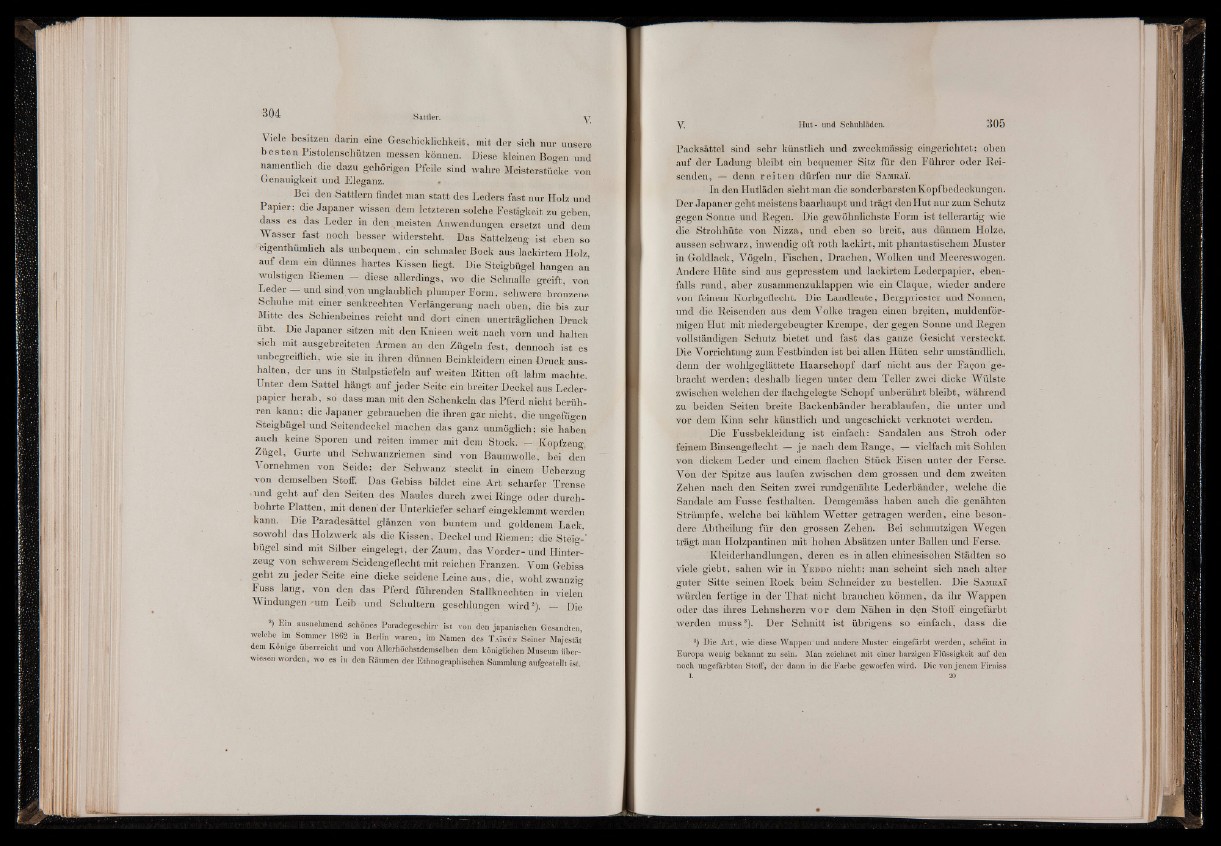
Viele besitzen darin eine Geschicklichkeit, mit der sich nur unsere
b e s t e n Pistolenschützen messen können. Diese kleinen Bogen und
namentlich die dazu gehörigen Pfeile sind wahre Meisterstücke von
Genauigkeit und Eleganz. .
Bei den Sattlern findet man statt des Leders fast nur Holz und
Papier; die Japaner wissen dem letzteren solche Festigkeit zu geben,
dass es das Leder in den meisten Anwendungen ersetzt und dem
Wasser fast noch besser widersteht. Das Sattelzeug ist eben so
eigenthümlich als unbequem, ein schmaler Bock aus lackirtem Holz,
auf dem ein dünnes hartes Kissen liegt. Die Steigbügel hangen an
wulstigen Kiemen - diese allerdings, wo die Schnalle greift, von
Leder und sind von unglaublich plumper Form, schwere bronzene
Schuhe mit einer senkrechten Verlängerung nach oben, die bis zur
Mitte des Schienbeines reicht und dort einen unerträglichen Druck
übt. Die Japaner sitzen mit den Knieen weit nach vorn und halten
sich mit ausgebreiteten Armen an den Zügeln fest, dennoch ist es
unbegreiflich, wie sie in ihren dünnen Beinkleidern einen Druck aus-
halten, der uns in Stulpstiefeln auf weiten Ritten oft lahm machte.
Unter dem Sattel hängt auf jeder Seite ein breiter Deckel aus Lederpapier
herab, so dass man mit den Schenkeln das Pferd nicht berühren
kann; die Japaner gebrauchen die ihren gar nicht, die ungefügen
Steigbügelund Seitendeckel machen das ganz unmöglich; sie haben
auch keine Sporen und reiten immer mit dem Stock. — Kopfzeug,
Zügel, Gurte und Schwanzriemen sind von Baumwolle, bei den
Vornehmen von Seide; der Schwanz steckt in einem Ueberzug
von demselben Stoff, Das Gebiss bildet eine Art scharfer Trense
und geht auf den Seiten des Maules durch zwei Ringe oder durchbohrte
Platten, mit denen der Unterkiefer scharf eingeklemmt werden
kann. Die Paradesättel glänzen von buntem und goldenem Lack,
sowohl das Holz werk als die Kissen, Deckel und Riemen; die Steig-'
bügel sind mit Silber eingelegt, der Zaum, das Vorder - und Hinterzeug
von schwerem Seidengeflecht mit reichen Franzen. Vom Gebiss
geht zu jeder Seite eine dicke seidene Leine aus', die, wohl zwanzig
Fuss lang, von den das Pferd führenden Stallknechten in vielen
Windungen 'um Leib und Schultern geschlungen wird2). Die
2) Em ausnehmend schönes Paradegeschirr ist von den japanischen Gesandten,
welche im Sommer 1862 in Berlin waren, im Namen des T a Ik ü n Seiner Majestät
dem Könige überreicht und von Allerhöchstdemselben dem königlichen Museum überwiesen
worden, wo es in den Räumen der Ethnographischen Sammlung aufgestellt ist.
Packsättel sind sehr künstlich und zweckmässig eingerichtet; oben
auf der Ladung bleibt ein bequemer Sitz für den Führer oder Reisenden,
— denn r e it e n dürfen nur die S a m r a ü .
In den Hutläden sieht man die sonderbarsten Kopfbedeckungen.
Der Japaner geht meistens baarhaupt und trägt denHut nur zum Schutz
gegen Sonne und Regen. Die gewöhnlichste Form ist tellerartig wie
die Strohhüte von Nizza, und eben so breit, aus dünnem Holze,
aussen schwarz, inwendig oft roth lackirt,mit phantastischem Muster
in Goldlack, Vögeln, Fischen, Drachen, Wolken und Meereswogen.
Andere Hüte sind aus gepresstem und lackirtem Lederpapier, ebenfalls
rund, aber zusammenzuklappen wie ein Claque, wieder andere
von feinem Korbgeflecht. Die Landleute, Bergpriester und Nonnen,
und die Reisenden aus dem Volke tragen einen breiten, muldenförmigen
Hut mit niedergebeugter Krempe, der gegen Sonne und Regen
vollständigem Schutz bietet und fast das ganze Gesicht versteckt.
Die Vorrichtung zum Festbinden ist bei allen Hüten sehr umständlich,
denn der wohlgeglättete Haarschopf darf nicht aus der Façon gebracht
werden; deshalb liegen unter dem Teller zwei dicke Wülste
zwischen welchen der flachgelegte Schopf unberührt bleibt, während
zu beiden Seiten breite Backenbänder herablaufen, die unter und
vor dem Kinn sehr künstlich und ungeschickt verknotet werden.
Die Fussbékleidung ist einfach: Sandalen aus Stroh oder
feinem Binsengeflecht — je nach dem Range, — vielfach mit Sohlen
von dickem Leder und einem flachen Stück Eisen unter der Ferse.
Von der Spitze aus laufen zwischen dem grossen und dem zweiten
Zehen nach den Seiten zwei rundgenähte Lederbänder, welche die
Sandale am Fusse festhalten. Deingemäss haben auch die genähten
Strümpfe, welche bei kühlem Wetter getragen werden, eine besondere
Abtheilung für den grossen Zehen. Bei schmutzigen Wegen
trägt man Holzpantinen mit hohen Absätzen unter Ballen und F erse.
Kleiderhandlungen, deren és in allen chinesischen Städten so
viele giebt, sahen wir in Y e d d o nicht; man scheint sich nach alter
guter Sitte seinen Rock beim Schneider zu bestellen. Die S a m r a ï
würden fertige in der That nicht brauchen können, da ihr Wappen
oder das ihres Lehnsherrn v o r dem Nähen in den Stoff eingefärbt
werden muss2). Der Schnitt ist übrigens so einfach, dass die
3) Die Art, wie diese .Wappen'und andere Muster eingefärbt werden, scheint in
Europa wenig bekannt zu sein. Man zeichnet mit einer hai*zigen Flüssigkeit auf den
noch ungefärbten Stoff, der dann in die Farbe geworfen wird. Die von jenem Firniss