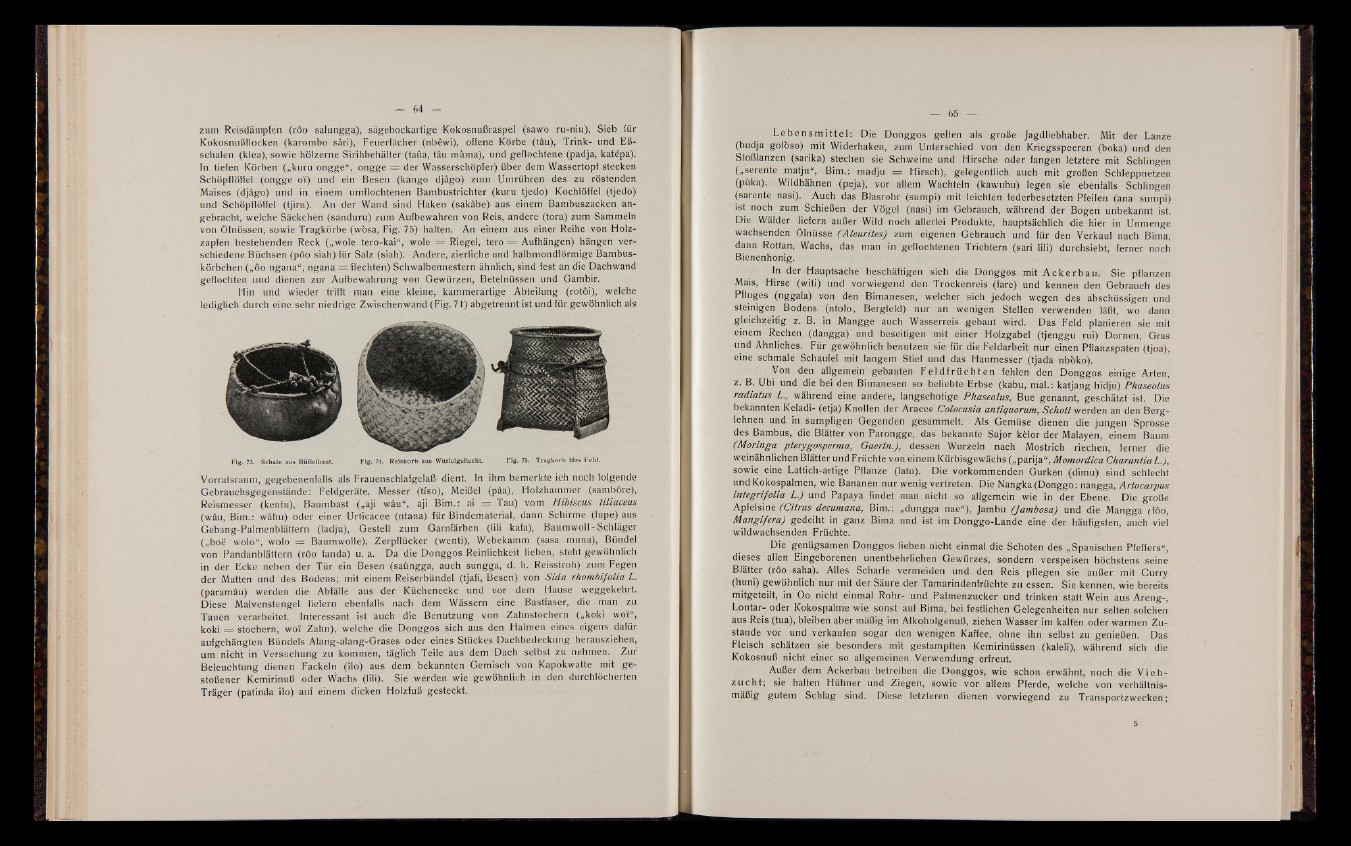
zum Reisdämpfen (röo salungga), sägebockartige Kokosnußraspel (sawo ru-niu), Sieb für
Kokosnußflocken (karombo säri), Feuerfächer (nbewi), offene Körbe (tau), Trink- und Eß-
schalen (klea), sowie hölzerne Sirihbehälter (taüa, täu mäma), und geflochtene (padja, katöpa).
In tiefen Körben („kuru ongge“, ongge = der Wasserschöpfer) über dem Wassertopf stecken
Schöpflöffel (ongge o'i) und ein Besen (kango djägo) zum Umrühren des zu röstenden
Maises (djägo) und in einem umflochtenen Bambustrichter (kuru tjedo) Kochlöffel (tjedo)
und Schöpflöffel (tjiru). An der Wand sind Haken (sakäbe) aus einem Bambuszacken angebracht,
welche Säckchen (sanduru) zum Aufbewahren von Reis, andere (tora) zum Sammeln
von Ölnüssen, sowie Tragkörbe (wösa, Fig. 75) halten. An einem aus einer Reihe von Holzzapfen
bestehenden Reck („wole tero-kai“, wole = Riegel, tero = Auihängen) hängen verschiedene
Büchsen (p6o siah) für Salz (siah). Andere, zierliche und halbmondförmige Bambuskörbchen
( „6 0 ngana“, ngana = flechten) Schwalbennestern ähnlich, sind fest an die Dachwand
geflochten und dienen zur Aufbewahrung von Gewürzen, Betelnüssen und Gambir.
Hin und wieder trifft man eine kleine, kammerartige Abteilung (rotöi), welche
lediglich durch eine sehr niedrige Zwischenwand (Fig. 71) abgetrennt ist und für gewöhnlich als
Fig. 73. Sch a le aus Büffelhaut. Fig. 74. R e iskorb aus Würfe lge fle cht Flg. 75. T rag k o rb fürs Feld.
Vorratsraum, gegebenenfalls als Frauenschlafgelaß dient. In ihm bemerkte ich noch folgende
Gebrauchsgegenstände: Feldgeräte, Messer (tiso), Meißel (päa), Holzhammer (samböre),
Reismesser (kentu), Baumbast („aji wäu“, aji Bim.: ai Tau) vom Hibiscus tiliaceus
(wäu, Bim.: wähu) oder einer Urticacee (ntana) für Bindematerial, dann Schirme (lupe) aus
Gebang-Palmenblättern (ladju), Gestell zum Garnfärben (lili kafa), Baumwoll- Schläger
(„boe wolo“, wolo = Baumwolle), Zerpflücker (wenti), Webekamm (sasa muna), Bündel
von Pandanblättern (röo fanda) u. a. Da die Donggos Reinlichkeit lieben, steht gewöhnlich
in der Ecke neben der Tür ein Besen (saüngga, auch sungga, d. h. Reisstroh) zum Fegen
der Matten und des Bodens; mit einem Reiserbündel (tjafi, Besen) von Sida rhombifolia L.
(paramäu) werden die Abfälle aus der Küchenecke und vor dem Hause weggekehrt.
Diese Malvenstengel liefern ebenfalls nach dem Wässern eine Bastfaser, die man zu
Tauen verarbeitet. Interessant ist auch die Benutzung von Zahnstochern („koki wdi“,
koki = stochern, wo'i Zahn), welche die Donggos sich aus den Halmen eines eigens dafür
aufgehängten Bündels Alang-alang-Grases oder eines Stückes Dachbedeckung herausziehen,
um nicht in Versuchung zu kommen, täglich Teile aus dem Dach selbst zu nehmen. Zur
Beleuchtung dienen Fackeln (tlo) aus dem bekannten Gemisch von Kapokwatte mit gestoßener
Kemirinuß oder Wachs (lili). Sie werden wie gewöhnlich in den durchlöcherten
Träger (patinda ilo) auf einem dicken Holzfuß gesteckt.
Le be n smi t t e l : Die Donggos gelten als große Jagdliebhaber. Mit der Lanze
(budja golóso) mit Widerhaken, zum Unterschied von den Kriegsspeeren (boka) und den
Stoßlanzen (sarika) stechen sie Schweine und Hirsche oder fangen letztere mit Schlingen
(„serente matju“, Bim.: madju = Hirsch), gelegentlich auch mit großen Schleppnetzen
(püka). Wildhähnen (peja), vor allem Wachteln (kawubu) legen sie ebenfalls Schlingen
(sarente nasi). Auch das Blasrohr (sumpi) mit leichten federbesetzten Pfeilen (ana sumpi)
ist noch zum Schießen der Vögel (nasi) im Gebrauch, während der Bogen unbekannt ist.
Die Wälder liefern außer Wild noch allerlei Produkte, hauptsächlich die hier in Unmenge
wachsenden Ölnüsse (Äleurites) zum eigenen Gebrauch und für den Verkauf nach Bima,
dann Rottan, Wachs, das man in geflochtenen Trichtern (sari lili) durchsiebt, ferner noch
Bienenhonig.
In der Hauptsache beschäftigen sich die Donggos mit Ac k e r b a u . Sie pflanzen
Mais, Hirse (witi) und vorwiegend den Trockenreis (fare) und kennen den Gebrauch des
Pfluges (nggala) von den Bimanesen, welcher sich jedoch wegen des abschüssigen und
steinigen Bodens (ntolo, Bergfeld) nur an wenigen Stellen verwenden läßt, wo dann
gleichzeitig z. B. in Mangge auch Wasserreis gebaut wird. Das Feld planieren sie mit
einem Rechen (dangga) und beseitigen mit einer Holzgabel (tjenggu rui) Dornen, Gras
und Ähnliches. Für gewöhnlich benutzen sie für die Feldarbeit nur einen Pflanzspaten (tjoa),
eine schmale Schaufel mit langem Stiel und das Haumesser (tjada nbbko).
Von den allgemein gebauten F e l d f r ü c h t e n fehlen den Donggos einige Arten,
z. B. Ubi und die bei den Bimanesen so beliebte Erbse (kabu, mal. : katjang hidju) Phaseolus
radiatus L., während eine andere, langschotige Phaseolus, Bue genannt, geschätzt ist. Die
bekannten Keladi- (etja) Knollen der Aracee Colocasia antiquorum, Schott werden an den Berglehnen
und in sumpfigen Gegenden gesammelt. Als Gemüse dienen die jungen Sprosse
des Bambus, die Blätter von Parongge, das bekannte Sajor kèlor der Malayen, einem Baum
(Moringa pterygosperma, Gaertn.), dessen Wurzeln nach Mostrich riechen, ferner die
weinähnlichen Blätter und Früchte von einem Kürbisgewächs („parija“, Momordica CharantiaL.),
sowie eine Lattich-artige Pflanze (latu). Die vorkommenden Gurken (dimu) sind schlecht
und Kokospalmen, wie Bananen nur wenig vertreten. Die Nangka (Donggo: nangga, Artocarpus
integrifolia L.) und Papaya findet man nicht so allgemein wie in der Ebene. Die große
Apfelsine (Citrus decumana, Bim.: „dungga nae“), Jambu (Jambosa) und die Mangga (föo,
Mangifera) gedeiht in ganz Bima und ist im Donggo-Lande eine der häufigsten, auch viel
wildwachsenden Früchte.
Die genügsamen Donggos lieben nicht einmal die Schoten des „Spanischen Pfeifers“,
dieses allen Eingeborenen unentbehrlichen Gewürzes, sondern verspeisen höchstens seine
Blätter (röo saha). Alles Scharfe vermeiden und den Reis pflegen sie außer mit Curry
(huni) gewöhnlich nur mit der Säure der Tamarindenfrüchte zu essen. Sie kennen, wie bereits
mitgeteilt, in Oo nicht einmal Rohr- und Palmenzucker und trinken statt Wein aus Areng-,
Lontar- oder Kokospalme wie sonst auf Bima, bei festlichen Gelegenheiten nur selten solchen
aus Reis (tua), bleiben aber mäßig im Alkoholgenuß, ziehen Wasser im kalten oder warmen Zustande
vor und verkaufen sogar den wenigen Kaffee, ohne ihn selbst zu genießen. Das
Fleisch schätzen sie besonders mit gestampften Kemirinüssen (kaleli), während sich die
Kokosnuß nicht einer so allgemeinen Verwendung erfreut.
Außer dem Ackerbau betreiben die Donggos, wie schon erwähnt, noch die Vi eh zucht
; sie halten Hühner und Ziegen, sowie vor allem Pferde, welche von verhältnismäßig
gutem Schlag sind. Diese letzteren dienen vorwiegend zu Transportzwecken;