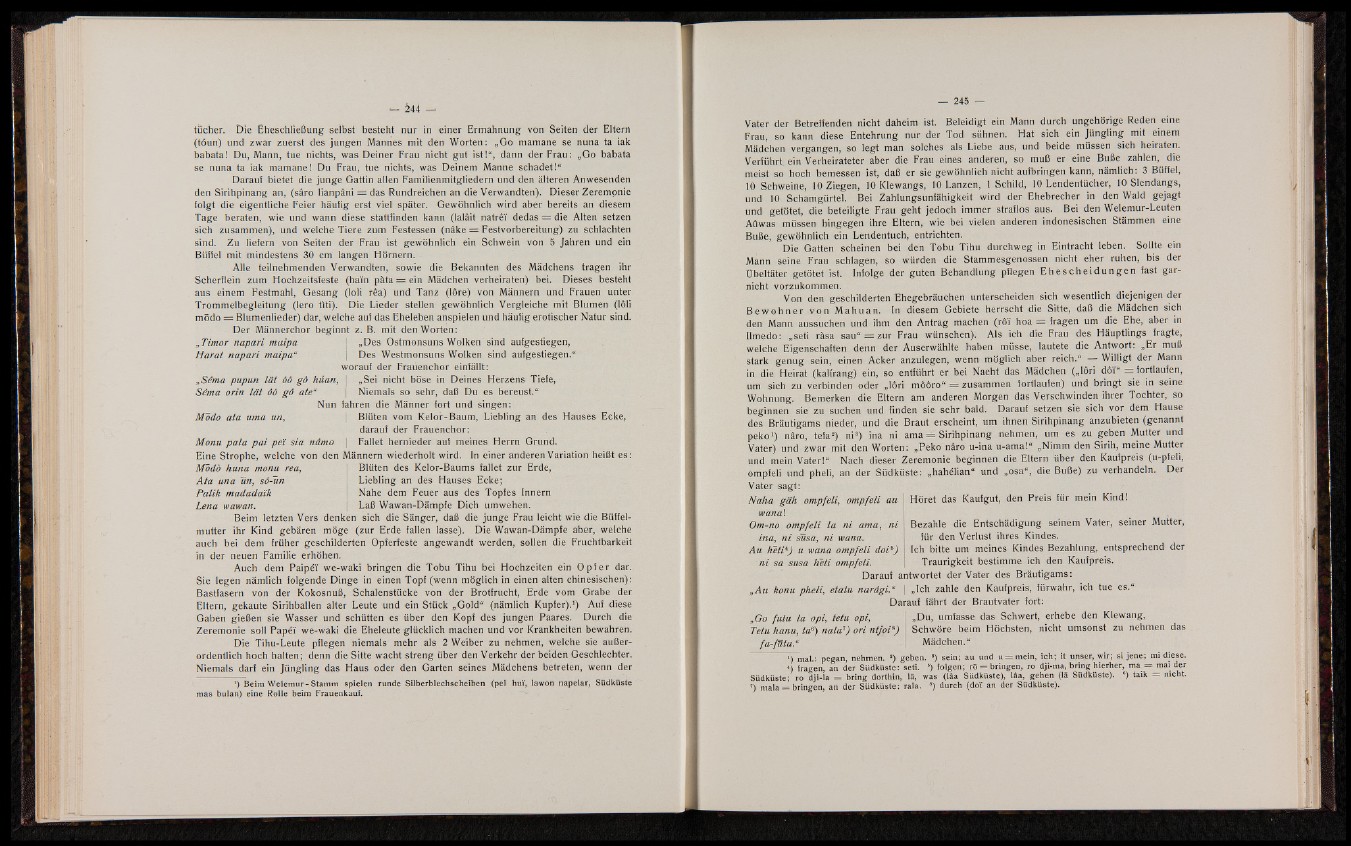
tücher. Die Eheschließung selbst besteht nur in einer Ermahnung von Seiten der Eltern
(töun) und zwar zuerst des jungen Mannes mit den Worten: „Go mamane se nuna ta iak
babata! Du, Mann, tue nichts, was Deiner Frau nicht gut ist 1“, dann der Frau: „Go babata
se nuna ta iak mamane 1 Du Frau, tue nichts, was Deinem Manne schadet 1“
Darauf bietet die junge Gattin allen Familienmitgliedern und den älteren Anwesenden
den Sirihpinang an, (säro lianpäni = das Rundreichen an die Verwandten). Dieser Zeremonie
folgt die eigentliche Feier häufig erst viel später. Gewöhnlich wird aber bereits an diesem
Tage beraten, wie und wann diese stattfinden kann (laläit natr£T dedas = die Alten setzen
sich zusammen), und welche Tiere zum Festessen (näke = Festvorbereitung) zu schlachten
sind. Zu liefern von Seiten der Frau ist gewöhnlich ein Schwein von 5 Jahren und ein
Büffel mit mindestens 30 cm langen Hörnern.
Alle teilnehmenden Verwandten, sowie die Bekannten des Mädchens tragen ihr
Scherflein zum Hochzeitsfeste (hain päta = ein Mädchen verheiraten) bei. Dieses besteht
aus einem Festmahl, Gesang (loli r£a) und Tanz (löre) von Männern und Frauen unter
Trommelbegleitung (lero tlti). Die Lieder stellen gewöhnlich Vergleiche mit Blumen (löli
modo = Blumenlieder) dar, welche auf das Eheleben anspielen und häufig erotischer Natur sind.
Der Männerchor beginnt z. B. mit den Worten:
„Timor napari maipa I „Des Ostmonsuns Wolken sind aufgestiegen,
Harat napari maipaI | Des Westmonsuns Wolken sind aufgestiegen.“
worauf der Frauenchor einfällt:
„Sima pupun lät 66 g6 hdan, I „Sei nicht böse in Deines Herzens Tiefe,
S im a orin lät 66 gö ate“ ~| Niemals so sehr, daß Du es bereust.“
Nun fahren die Männer fort und singen:
Modo ata uma un, | Blüten vom Kelor-Baum, Liebling an des Hauses Ecke,
darauf der Frauenchor:
Monu pala p a i pei sia ndmo \ Fallet hernieder auf meines Herrn Grund.
Eine Strophe, welche von den Männern wiederholt wird. In einer anderen Variation heißt es:
Modö huna monu rea, I Blüten des Kelor-Baums fallet zur Erde,
A ta una un, s6-un Liebling an des Hauses Ecke;
Palik madadaik Nahe dem Feuer aus des Topfes Innern
Lena wawan. | Laß Wawan-Dämpfe Dich umwehen.
Beim letzten Vers denken sich die Sänger, daß die junge Frau leicht wie die Büffelmutter
ihr Kind gebären möge (zur Erde fallen lasse). Die Wawan-Dämpfe aber, welche
auch bei dem früher geschilderten Opferfeste angewandt werden, sollen die Fruchtbarkeit
in der neuen Familie erhöhen.
Auch dem Paipdi we-waki bringen die Tobu Tihu bei Hochzeiten ein Op f e r dar.
Sie legen nämlich folgende Dinge in einen Topf (wenn möglich in einen alten chinesischen):
Bastfasern von der Kokosnuß, Schalenstücke von der Brotfrucht, Erde vom Grabe der
Eltern, gekaute Sirihballen alter Leute und ein Stück „Gold“ (nämlich Kupfer).1) Auf diese
Gaben gießen sie Wasser und schütten es über den Kopf des jungen Paares. Durch die
Zeremonie soll Pap6i we-waki die Eheleute glücklich machen und vor Krankheiten bewahren.
Die Tihu-Leute pflegen niemals mehr als 2 Weiber zu nehmen, welche sie außerordentlich
hoch halten; denn die Sitte wacht streng über den Verkehr der beiden Geschlechter.
Niemals darf ein Jüngling das Haus oder den Garten seines Mädchens betreten, wenn der
J) Beim Welemur-Stamm spielen runde Silberblechscheiben (pel hui', lawon napelar, Südküste
mas bulan) eine Rolle beim Frauenkauf.
Vater der Betreffenden nicht daheim ist. Beleidigt ein Mann durch ungehörige Reden eine
Frau, so kann diese Entehrung nur der Tod sühnen. Hat sich ein Jüngling mit einem
Mädchen vergangen, so legt man solches als Liebe aus, und beide müssen sich heiraten.
Verführt ein Verheirateter aber die Frau eines anderen, so muß er eine Buße zahlen, die
meist so hoch bemessen ist, daß er sie gewöhnlich nicht aufbringen kann, nämlich: 3 Büffel,
10 Schweine, 10 Ziegen, 10 Klewangs, 10 Lanzen, 1 Schild, 10 Lendentücher, 10 Slendangs,
und 10 Schamgürtel. Bei Zahlungsunfähigkeit wird der Ehebrecher in den Wald gejagt
und getötet, die beteiligte Frau geht jedoch immer straflos aus. Bei den Welemur-Leuten
Aöwas müssen hingegen ihre Eltern, wie bei vielen anderen indonesischen Stämmen eine
Buße, gewöhnlich ein Lendentuch, entrichten.
Die Gatten scheinen bei den Tobu Tihu durchweg in Eintracht leben. Sollte ein
Mann seine Frau schlagen, so würden die Stammesgenossen nicht eher ruhen, bis der
Übeltäter getötet ist. Infolge der guten Behandlung pflegen E h e s c h e i d u n g e n fast gar-
nicht vorzukommen.
Von den geschilderten Ehegebräuchen unterscheiden sich wesentlich diejenigen der
Be wo h n e r Von Mahuan. In diesem Gebiete herrscht die Sitte, daß die Mädchen sich
den Mann aussuchen und ihm den Antrag machen (röT hoa == fragen um die Ehe, aber in
Ilmedo: „seti ràsa sau“r = zur Frau wünschen). Als ich die Frau des Häuptlings fragte,
welche Eigenschaften, denn der Auserwählte haben müsse, lautete die Antwort: „Er muß
stark genug sein, einen Acker anzulegen, wenn möglich aber reich.“ — Willigt der Mann
in die Heirat (kalirang) ein, so entführt er bei Nacht das Mädchen („lòri d ò P '= fortlaufen,
um sich zu verbinden oder „lòri mööro“ = zusammen fortlaufen) und bringt , sie in seine
Wohnung. Bemerken die Eltern am anderen Morgen das Verschwinden ihrer Tochter, so
beginnen sie zu suchen und finden sie sehr bald. Darauf setzen sie sich vor dem Hause
des Bräutigams nieder, und die Braut erscheint, um ihnen Sirihpinang anzübieten (genannt
peko1) näro, tefa2) nis) ina ni ama =SSirihpinang nehmen, um es zu geben Mutter und
Vater) und zwar mit den Worten: „Peko näro u-ina u-amal“ „Nimm den Sirih, meine Mutter
und mein Vaterl“ Nach dieser Zeremonie beginnen die Eltern über den Kaufpreis (u-pfeli,
ompfeli und pheli, an der Südküste: „hahélian“ und „osa“, die Buße) zu verhandeln. Der
Vater sagt:
Naha gäh ompfeli, ompfeli au I Höret das Kaufgut, den Preis für mein Kindl
wana\ _
Om-no ompfeli la ni ama, n i ] Bezahle die Entschädigung seinem Vater, seiner Mutter,
ina, n i susa, n i wana. für den Verlust ihres Kindes.
A u lièti*) u wana ompfeli doi6) Ich bitte um meines Kindes Bezahlung, entsprechend der
n i sa susa lièti ompfeli. | Traurigkeit bestimme ich den Kaufpreis.
Darauf antwortet der Vater des Bräutigams:
„Au konu pheli, etalu nardgi.“ | „Ich zahle den Kaufpreis, fürwahr, ich tue es.“
Darauf fährt der Brautvater fort:
„Go fu iu la opi, tetu opi, I „Du, umfasse das Schwert, erhebe den Klewang,
Tetu hanu, la*) naia1) ori ntjoi") j Schwöre beim Höchsten, nicht umsonst zu nehmen das
fa-fnta.“ ■ | Mädchen.“1!;;,
iTmal.: pegan, nehmen. ■) geben. *) sein; au und u = mein, ich; it unspr, wir; si jene; mi diese.
‘) fragen, an der Südküste: seti. ') folgen; rö = bringen, ro d j i - n ^ bring hierher, ma f g mai der
Südküste; ro dji-la = bring dorthin, lä, was (läa Südküste), 14a, gehen (lä Südküste). ’) taik = nicht.
') mala = :bringen, an der Südküste: raia. “) durch (doi an der Südküsfe).