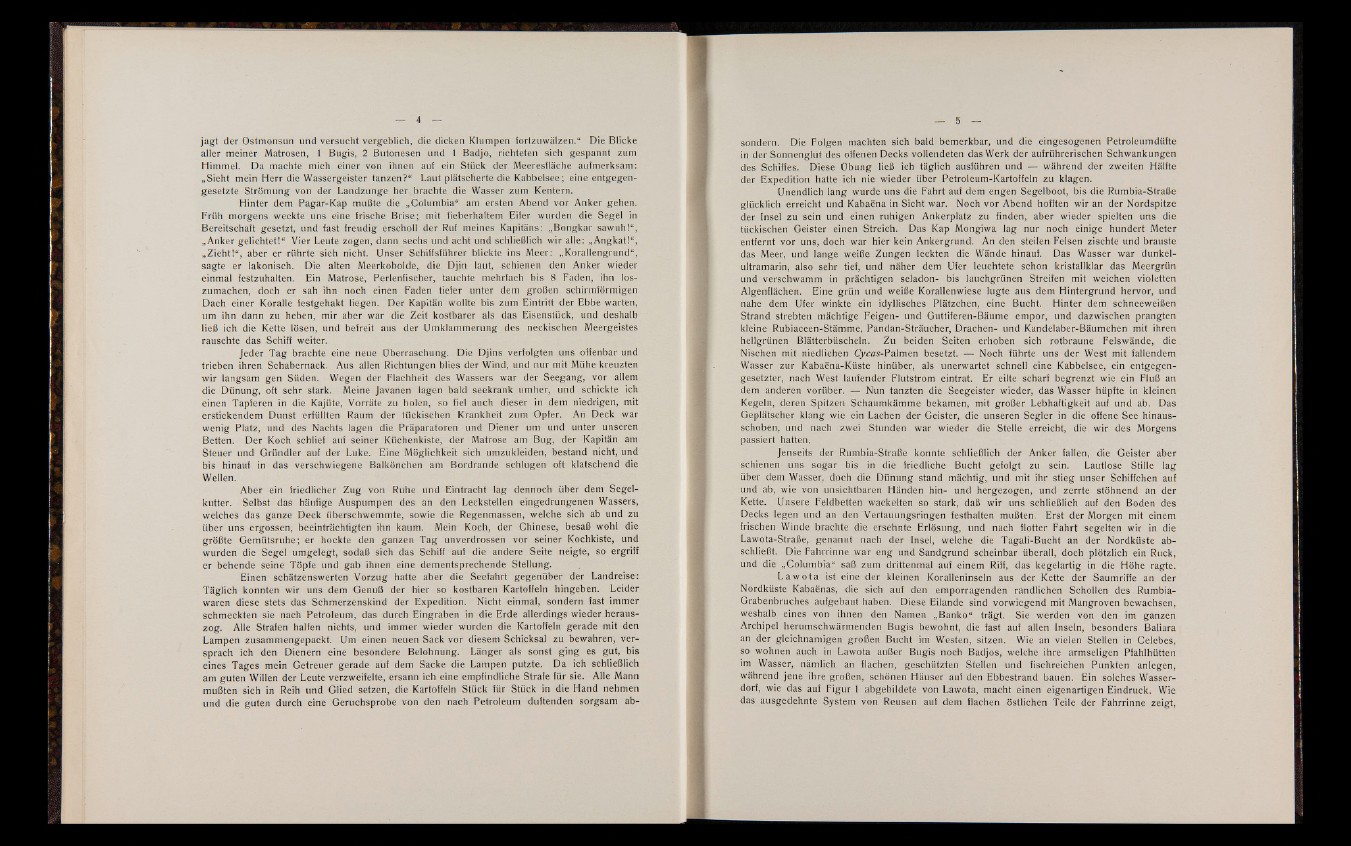
jagt der Ostmonsun und versucht vergeblich, die dicken Klumpen fortzuwälzen.“ Die Blicke
aller meiner Matrosen, 1 Bugis, 2 Butonesen und 1 Badjo, richteten sich gespannt zum
Himmel. Da machte mich einer von ihnen auf ein Stück der Meeresfläche aufmerksam:
„Sieht mein Herr die Wassergeister tanzen?“ Laut plätscherte die Kabbelsee; eine entgegengesetzte
Strömung von der Landzunge her brachte die Wasser zum Kentern.
Hinter dem Pagar-Kap mußte die „Columbia“ am ersten Abend vor Anker gehen.
Früh morgens weckte uns eine frische Brise; mit fieberhaftem Eifer wurden die Segel in
Bereitschaft gesetzt, und fast freudig erscholl der Ruf meines Kapitäns: „Bongkar sawuhl“,
„Anker gelichtet!“ Vier Leute zogen, dann sechs und acht und schließlich wir alle: „Angkatl“,
„Ziehtl“, aber er rührte sich nicht. Unser Schiffsführer blickte ins Meer: „Korallengrund“,
sagte er lakonisch. Die alten Meerkobolde, die Djin laut, schienen den Anker wieder
einmal festzuhalten. Ein Matrose, Perlenfischer, tauchte mehrfach bis 8 Faden, ihn loszumachen,
doch er sah ihn noch einen Faden tiefer unter dem großen schirmförmigen
Dach einer Koralle festgehakt liegen. Der Kapitän wollte bis zum Eintritt der Ebbe warten,
um ihn dann zu heben, mir aber war die Zeit kostbarer als das Eisenstück, und deshalb
ließ ich die Kette lösen, und befreit aus der Umklammerung des neckischen Meergeistes
rauschte das Schiff weiter.
Jeder Tag brachte eine neue Überraschung. Die Djins verfolgten uns offenbar und
trieben ihren Schabernack. Aus allen Richtungen blies der Wind, und nur mit Mühe kreuzten
wir langsam gen Süden. Wegen der Flachheit des Wassers war der Seegang, vor allem
die Dünung, oft sehr stark. Meine Javanen lagen bald seekrank umher, und schickte ich
einen Tapferen in die Kajüte, Vorräte zu holen, so fiel auch dieser in dem niedrigen, mit
erstickendem Dunst erfüllten Raum der tückischen Krankheit zum Opfer. An Deck war
wenig Platz, und des Nachts lagen die Präparatoren und Diener um und unter unseren
Betten. Der Koch schlief auf seiner Küchenkiste, der Matrose am Bug, der Kapitän am
Steuer und Gründler auf der Luke. Eine Möglichkeit sich umzukleiden, bestand nicht, und
bis hinauf in das verschwiegene Balkönchen am Bordrande schlugen oft klatschend die
Wellen.
Aber ein friedlicher Zug von Ruhe und Eintracht lag dennoch über dem Segelkutter.
Selbst das häufige Auspumpen des an den Leckstellen eingedrungenen Wassers,
welches das ganze Deck überschwemmte, sowie die Regenmassen, welche sich ab und zu
über uns ergossen, beeinträchtigten ihn kaum. Mein Koch, der Chinese, besaß wohl die
größte Gemütsruhe; er hockte den ganzen Tag unverdrossen vor seiner Kochkiste, und
wurden die Segel umgelegt, sodaß sich das Schiff auf die andere Seite neigte, so ergriff
er behende seine Töpfe und gab ihnen eine dementsprechende Stellung.
Einen schätzenswerten Vorzug hatte aber die Seefahrt gegenüber der Landreise:
Täglich konnten wir uns dem Genuß der hier so kostbaren Kartoffeln hingeben. Leider
waren diese stets das Schmerzenskind der Expedition. Nicht einmal, sondern fast immer
schmeckten sie nach Petroleum, das durch Eingraben in die Erde allerdings wieder herauszog.
Alle Strafen halfen nichts, und immer wieder wurden die Kartoffeln gerade mit den
Lampen zusammengepackt. Um einen neuen Sack vor diesem Schicksal zu bewahren, versprach
ich den Dienern eine besondere Belohnung. Länger als sonst ging es gut, bis
eines Tages mein Getreuer gerade auf dem Sacke die Lampen putzte. Da ich schließlich
am guten Willen der Leute verzweifelte, ersann ich eine empfindliche Strafe für sie. Alle Mann
mußten sich in Reih und Glied setzen, die Kartoffeln Stück für Stück in die Hand nehmen
und die guten durch eine Geruchsprobe von den nach Petroleum duftenden sorgsam absondern.
Die Folgen machten sich bald bemerkbar, und die eingesogenen Petroleumdüfte
in der Sonnenglut des offenen Decks vollendeten das Werk der aufrührerischen Schwankungen
des Schiffes. Diese Übung ließ ich täglich ausführen und —r während der zweiten Hälfte
der Expedition hatte ich nie wieder über Petroleum-Kartoffeln zu klagen.
Unendlich lang wurde uns die Fahrt auf dem engen Segelboot, bis die Rumbia-Straße
glücklich erreicht und Kabaena in Sicht war. Noch vor Abend hofften wir an der Nordspitze
der Insel zu sein und einen ruhigen Ankerplatz zu finden, aber wieder spielten uns die
tückischen Geister einen Streich. Das Kap Mongiwa lag nur noch einige hundert Meter
entfernt vor uns, doch war hier kein Ankergrund. An den steilen Felsen zischte und brauste
das Meer, und lange weiße Zungen leckten die Wände hinauf. Das Wasser war dunkelultramarin,
also sehr tief, und näher dem Ufer leuchtete schon kristallklar das Meergrün
und verschwamm in prächtigen seladon- bis lauchgrünen Streifen mit weichen violetten
Algenflächen. Eine grün und weiße Korallenwiese lugte aus dem Hintergrund hervor, und
nahe dem Ufer winkte ein idyllisches Plätzchen, eine Bucht. Hinter dem schneeweißen
Strand strebten mächtige Feigen- und Guttiferen-Bäume empor, und dazwischen prangten
kleine Rubiaceen-Stämme, Pandan-Sträucher, Drachen- und Kandelaber-Bäumchen mit ihren
hellgrünen Blätterbüscheln. Zu beiden Seiten erhoben sich rotbraune Felswände, die
Nischen mit niedlichen Cycas-Palmen besetzt. Noch führte uns der West mit fallendem
Wasser zur Kabaena-Küste hinüber, als unerwartet schnell eine Kabbelsee, ein entgegengesetzter,
nach West laufender Flutstrom eintrat. Er eilte scharf begrenzt wie ein Fluß an
dem anderen vorüber. — Nun tanzten die Seegeister wieder, das Wasser hüpfte in kleinen
Kegeln, deren Spitzen Schaumkämme bekamen, mit großer Lebhaftigkeit auf und ab. Das
Geplätscher klang wie ein Lachen der Geister, die unseren Segler in die offene See hinausschoben,
und nach zwei Stunden war wieder die Stelle erreicht, die wir des Morgens
passiert hatten.
Jenseits der Rumbia-Straße konnte schließlich der Anker fallen, die Geister aber
schienen uns sogar bis in die friedliche Bucht gefolgt zu sein. Lautlose Stille lag
über dem Wasser, doch die Dünung stand mächtig, und mit ihr stieg unser Schiffchen auf
und ab, wie von unsichtbaren Händen hin- und hergezogen, und zerrte stöhnend an der
Kette. Unsere Feldbetten wackelten so stark, daß wir uns schließlich auf den Boden des
Decks legen und an den Vertauungsringen festhalten mußten. Erst der Morgen mit einem
frischen Winde brachte die ersehnte Erlösung, und nach flotter Fahrt segelten wir in die
Lawota-Straße, genannt nach der Insel, welche die Tagali-Bucht an der Nordküste abschließt.
Die Fahrrinne war eng und Sandgrund scheinbar überall, doch plötzlich ein Ruck,
und die „Columbia“ saß zum drittenmal auf einem Riff, das kegelartig in die Höhe ragte.
L aw o ta ist eine der kleinen Koralleninseln aus der Kette der Saumriffe an der
Nordküste Kabaenas, die sich auf den emporragenden randlichen Schollen des Rumbia-
Grabenbruches aufgebaut haben. Diese Eilande sind vorwiegend mit Mangroven bewachsen,
weshalb eines von ihnen den Namen „Banko“ trägt. Sie werden von den im ganzen
Archipel herumschwärmenden Bugis bewohnt, die fast auf allen Inseln, besonders Baliara
an der gleichnamigen großen Bucht im Westen, sitzen. Wie an vielen Stellen in Celebes,
so wohnen auch in Lawota außer Bugis noch Badjos, welche ihre armseligen Pfahlhütten
im Wasser, nämlich an flachen, geschützten Stellen und fischreichen Punkten anlegen,
während jene ihre großen, schönen Häuser auf den Ebbestrand bauen. Ein solches Wasserdorf,
wie das auf Figur 1 abgebildete von Lawota, macht einen eigenartigen Eindruck. Wie
das ausgedehnte System von Reusen auf dem flachen östlichen Teile der Fahrrinne zeigt,