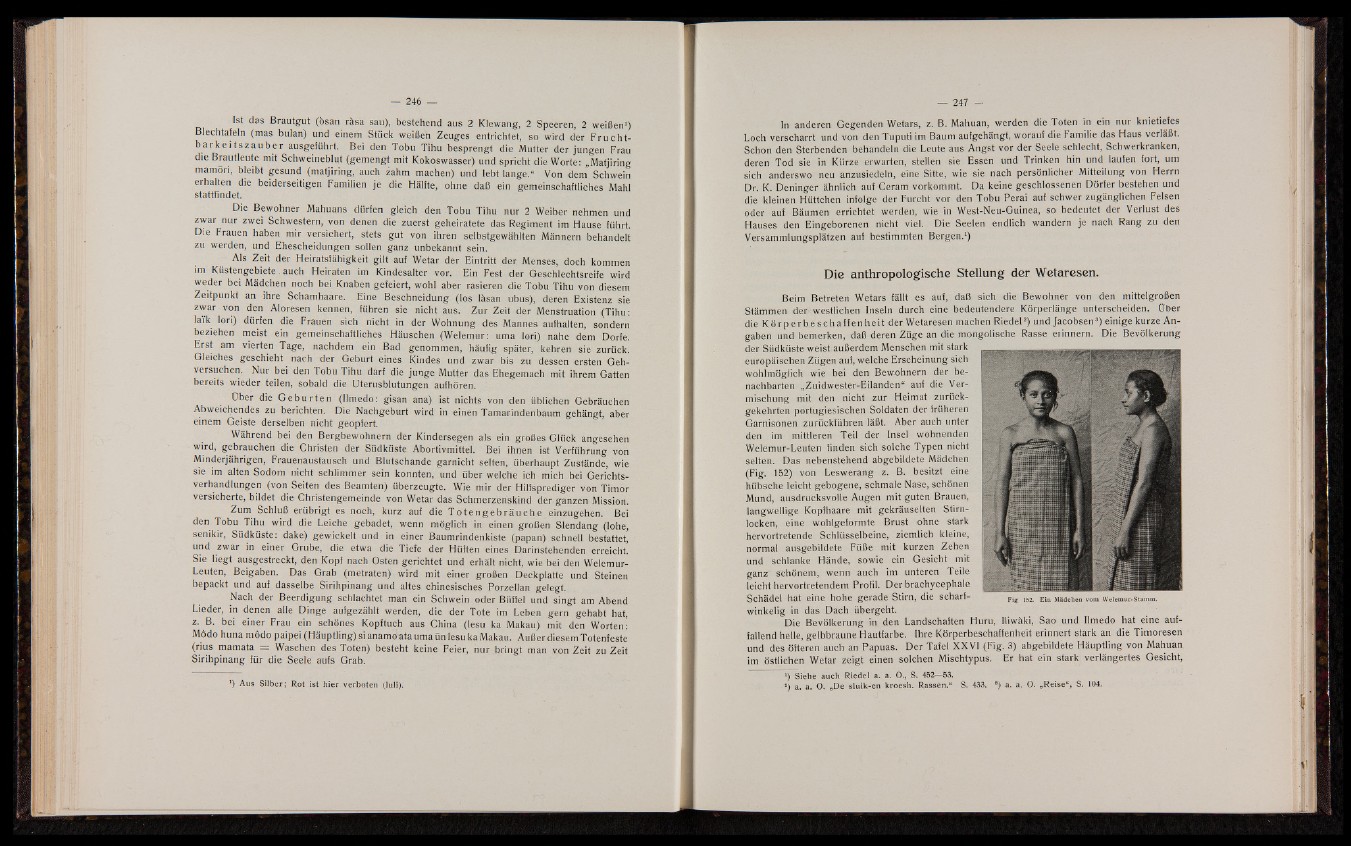
Ist das Brautgut (òsan ràsa sau), bestehend aus 2 Klewang, 2 Speeren, 2 weißen1)
Blechtafeln (mas bulan) und einem Stück weißeh Zeuges entrichtet, so wird der Frucht -
b a r k e i t s z a u b e r ausgeführt. Bei den Tobu Tihu besprengt die Mutter der jungen Frau
die Brautleute mit Schweineblut (gemengt mit Kokoswasser) und spricht die Worte: „Matjiring
mamori, bleibt gesund (matjiring, auch zahm machen) und lebt lange.“ Von dem” Schwein
erhalten die beiderseitigen Familien je die Hälfte, ohne daß ein gemeinschaftliches Mahl
stattfindet.
Die Bewohner Mahuans dürfen gleich den Tobu Tihu nur 2 Weiber nehmen und
zwar nur zwei Schwestern, von denen die zuerst geheiratete das Regiment im Hause führt.
Die Frauen haben mir versichert, stets gut von ihren selbstgewählten Männern behandelt
zu werden, und Ehescheidungen sollen ganz unbekannt sein.
Als Zeit der Heiratsfähigkeit gilt auf Wetar der Eintritt der Menses, doch kommen
im Küstengebiete auch Heiraten im Kindesalter vor. Ein Fest der Geschlechtsreife wird
weder bei Mädchen noch bei Knaben gefeiert, wohl aber rasieren die Tobu Tihu von diesem
Zeitpunkt an ihre Schamhaare. Eine Beschneidung (los làsan ubus), deren Existenz sie
zwar von den Aloresen kennen, führen sie nicht aus. Zur Zeit der Menstruation (Tihu:
lai'k lori) dürfen die Frauen sich nicht in der Wohnung des Mannes aufhalten, sondern
beziehen meist ein gemeinschaftliches Häuschen (Welemur: urna lori) nahe dem Dorfe.
Erst am vierten Tage, nachdem ein Bad genommen, häufig später, kehren sie zurück.
Gleiches geschieht nach der Geburt eines Kindes und zwar bis zu dessen ersten Gehversuchen.
Nur bei den Tobu Tihu darf die junge Mutter das Ehegemach mit ihrem Gatten
bereits wieder teilen, sobald di||Uterusblutungen aufhören.
Über die G e b u r t e n (Ilmedo: gisan ana) ist nichts von den üblichen Gebräuchen
Abweichendes zu berichten. Die Nachgeburt wird in einen Tamarindenbaum gehängt, aber
einem Geiste derselben nicht geopfert.
Während bei den Bergbewohnern der Kindersegen als ein großes Glück angesehen
wird, gebrauchen die Christen der Südküste Abortivmittel. Bei ihnen ist Verführung von
Minderjährigen, Frauenaustausch und Blutschande garnicht selten, überhaupt Zustände,, wie
sie im alten Sodom nicht schlimmer sein konnten, und über welche ich mich bei Gerichtsverhandlungen
(von Seiten des Beamten) überzeugte. Wie mir der Hilfsprediger von Timor
versicherte, bildet die Christengemeinde von Wetar das Schmerzenskind der ganzen Mission.
Zum Schluß erübrigt es noch, kurz auf die T o t e n g e b r ä u c h e einzugehen. Bei
den Tobu Tihu wird die Leiche gebadet, wenn möglich in einen großen Slendang (lohe,
senikir, Südküste: dake) gewickelt und in einer Baumrindenkiste (papan) schnell bestattet,
und zwar in einer Grube, die etwa die Tiefe der Hüften eines Darinstehenden erreicht'
Sie liegt ausgestreckt, den Kopf nach Osten gerichtet und erhält nicht, wie bei den Welemur-
Leuten, Beigaben. Das Grab (metraten) wird mit einer großen Deckplatte und Steinen
bepackt und auf dasselbe Sirihpinang und altes chinesisches Porzellan gelegt.
Nach der Beerdigung schlachtet man ein Schwein oder Büffel und singt am Abend
Lieder, in denen alle Dinge aufgezählt werden, die der Tote im Leben gern gehabt hat,
z. B. bei einer Frau ein schönes Kopftuch aus China (lesu ka Makau) mit den Worten:
Mòdo huna mòdo paipei (Häuptling) si anamö ata uma ün lesu ka Makau. Außer diesem Totenfeste
(rius marnata = Waschen des Toten) besteht keine Feier, nur bringt man von Zeit zu Zeit
Sirihpinang für die Seele aufs Grab.
*) Au s S ilb e r; Rot is t h ie r v e rb o te n (Juli).
In anderen Gegenden Wetars, z. B. Mahuan, werden die Toten in ein nur knietiefes
Loch verscharrt und von den Tuputi im Baum aufgehängt, worauf die Familie das Haus verläßt.
Schon den Sterbenden behandeln die Leute aus Angst vor der Seele schlecht, Schwerkranken,
deren Tod sie in Kürze erwarten, stellen sie Essen und Trinken hin und laufen fort, um
sich anderswo neu anzusiedeln, eine Sitte, wie sie nach persönlicher Mitteilung von Herrn
Dr. K. Deninger ähnlich auf Ceram vorkommt. Da keine geschlossenen Dörfer bestehen und
die kleinen Hüttchen infolge der Furcht vor den Tobu Perai auf schwer zugänglichen Felsen
oder auf Bäumen errichtet werden, wie in West-Neu-Guinea, so bedeutet der Verlust des
Hauses den Eingeborenen nicht viel. Die Seelen endlich wandern je nach Rang zu den
Versammlungsplätzen auf bestimmten Bergen.1)
Die anthropologische Stellung der Wetaresen.
Beim Betreten Wetars fällt es auf, daß sich die Bewohner von den mittelgroßen
Stämmen der-westlichen insein durch eine bedeutendere Körperlänge unterscheiden. Über
die Kö r p e r b e s c h a f f e n h e i t der Wetaresen machen Riedel2) und Jacobsen3) einige kurze Angaben
und bemerken, daß deren Züge an die mongolische Rasse erinnern. Die Bevölkerung
der Südküste weist außerdem Menschen mit stark
europäischen Zügen auf, welche Erscheinung sich
wohlmöglich wie bei den Bewohnern der benachbarten
„Zuidwester-Eilanden“ auf die Vermischung
mit den nicht zur Heimat zurückgekehrten
portugiesischen Soldaten der früheren
Garnisonen zurückführen läßt. Aber auch unter
den im mittleren Teil der Insel wohnenden
Welemur-Leuten finden sich solche Typen nicht
selten. Das nebenstehend abgebildete Mädchen
(Fig. 152) von Leswerang z. B. besitzt eine
hübsche leicht gebogene, schmale Nase, schönen
Mund, ausdrucksvolle Augen mit guten Brauen,
langwellige Kopfhaare mit gekräuselten Stirnlocken,
eine wohlgeformte Brust ohne stark
hervortretende Schlüsselbeine, ziemlich kleine,
normal ausgebildete Füße mit kurzen Zehen
und schlanke Hände, sowie ein Gesicht mit
ganz* schönem, wenn auch im unteren Teile
leicht hervortretendem Profil. Der brachycephale
Schädel hat eine hohe gerade Stirn, die scharfwinkelig
in das Dach übergeht,
Die Bevölkerung in den Landschaften Hurü, Iliwäki, Sao und Ilmedo hat eine auffallend
helle, gelbbraune Hautfarbe. Ihre Körperbeschaffenheit erinnert stark an die Timoresen
und des öfteren auch an Papuas. Der Tafel XXVI (Fig. 3) abgebildete Häuptling von Mahuan
im östlichen Wetar zeigt einen solchen Mischtypus. Er hat ein stark verlängertes Gesicht,
x) Siehe auch Riedel a. a. O., S. 452—53.
s) a. a. O. „De sluik-en kroesh. Rassen.“ S. 433. *) a. a. O. „Reise“, S. 104.