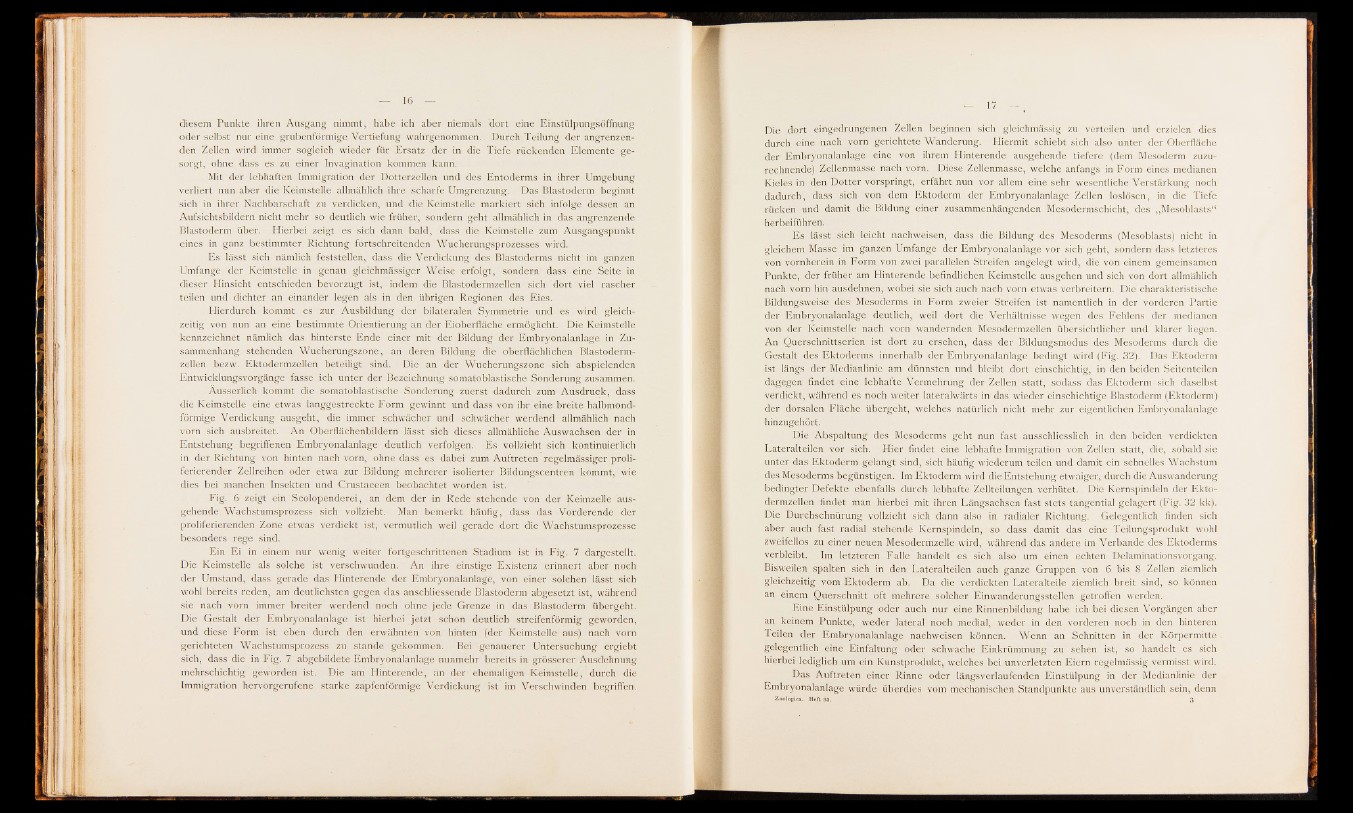
diesem Punkte ihren Ausgang nimmt, habe ich aber niemals dort eine Einstülpungsöffnung
oder selbst nur eine grübenförmige Vertiefung wahrgenommen. Durch Teilung der angrenzenden
Zellen wird immer sogleich wieder für Ersatz der in die Tiefe rückenden Elemente gesorgt,
ohne dass es zu einer Invagination kommen kann.
Mit der lebhaften Immigration der Dotterzellen und des Entoderms in ihrer Umgebung
verliert nun aber die Keimstelle allmählich ihre scharfe Umgrenzung. Das Blastoderm beginnt
sich in ihrer Nachbarschaft zu verdicken, und die Keimstelle markiert sich infolge dessen an
Aufsichtsbildern nicht mehr so deutlich wie früher, sondern geht allmählich in das angrenzende
Blastoderm über. Hierbei zeigt es sich dann bald, dass die Keimstelle zum Ausgangspunkt
eines in ganz bestimmter Richtung fortschreitenden Wucherungsprozesses wird.
Es lässt sich- nämlich feststellen, dass die Verdickung des Blastoderms nicht im ganzen
Umfange der Keimstelle in genau gleichmässiger Weise erfolgt, sondern dass eine Seite in
dieser Hinsicht entschieden bevorzugt ist, indem die Blastodermzellen sich dort viel rascher
teilen und dichter an einander legen als in den übrigen Regionen des Eies.
Hierdurch kommt es zur Ausbildung der bilateralen Symmetrie und es wird gleichzeitig
von nun an eine bestimmte Orientierung an der Eioberfläche ermöglicht. Die Keimstelle
kennzeichnet nämlich das hinterste Ende einer mit der Bildung der Embryonalanlage in Zusammenhang
stehenden Wucherungszone, an deren Bildung die oberflächlichen Blastodermzellen
bezw. Ektodermzellen beteiligt sind. Die an der Wucherungszone sich abspielenden
Entwicklungsvorgänge fasse ich unter der Bezeichnung somatobiastische Sonderung zusammen.
Ausserlich kommt die somatobiastische Sonderung zuerst dadurch zum Ausdruck, dass
die Keimstelle eine etwas langgestreckte Form gewinnt und dass von ihr eine breite halbmondförmige
Verdickung ausgeht, die immer schwächer und schwächer werdend allmählich nach
vorn sich ausbreitet. An Oberflächenbildern lässt sich dieses allmähliche Auswachsen der in
Entstehung begriffenen Embryonalanlage deutlich verfolgen. Es vollzieht sich kontinuierlich
in der Richtung von hinten nach vorn, ohne dass es dabei zum Auftreten regelmässiger prolL
ferierender Zellreihen oder etwa zur Bildung mehrerer isolierter Bildungscentren kommt, wie
dies bei manchen Insekten und Crustaceen beobachtet worden ist.
Fig. 6 zeigt ein Scolopenderei, an dem der in Rede stehende von der Keimzelle ausgehende
Wachstumsprozess sich vollzieht. Man bemerkt häufig, dass das Vorderende der
proliferierenden Zone etwas verdickt ist, vermutlich weil gerade dort die Wachstumsprozesse
besonders rege sind.
Ein Ei in einem nur wenig weiter fortgeschrittenen Stadium ist in Fig. 7 dargestellt.
Die Keimstelle als solche ist verschwunden. An ihre einstige Existenz erinnert aber noch
der Umstand, dass gerade, das Hinter.ende der Embryonalanlage, von einer solchen lässt sich
wohl bereits reden, am deutlichsten gegen das anschliessende Blastoderm abgesetzt ist, während
sie nach vorn immer breiter werdend noch ohne jede Grenze in das Blastoderm übergeht.
Die Gestalt der Embryonalanlage ist hierbei jetzt schon deutlich streifenförmig geworden,
und diese Form ist eben durch den erwähnten von hinten (der Keimstelle aus) nach vorn
gerichteten Wachstumsprozess zu Stande gekommen. Bei genauerer Untersuchung ergiebt
sich, dass die in Fig. 7 abgebildete Embryonalanlage nunmehr bereits in grösserer Ausdehnung
mehrschichtig geworden ist. Die am Hinterende, an der ehemaligen Keimstelle, durch die
Immigration hervörgerufene starke zapfenförmige Verdickung ist im Verschwinden begriffen.
Die dort eingedrungenen Zellen beginnen sich gleichmässig zu verteilen und erzielen dies
durch eine nach vorn gerichtete Wanderung. Hiermit schiebt sich also unter der Oberfläche
der Embryonalanlage eine von ihrem Hinterende ausgehende tiefere (dem Mesoderm zuzurechnende)
Zellenmasse nach vorn. Diese Zellenmasse, welche anfangs in Form eines medianen
Kieles in den Dotter vorspringt, erfährt nun vor allem eine sehr wesentliche Verstärkung noch
dadurch, dass sich von dem Ektoderm der Embryonalanlage Zellen loslösen, in die Tiefe
rücken und damit die Bildung einer zusammenhängenden Mesodermschicht, des „Mesoblasts“
herbeiführen.
Es lässt sich leicht nachweisen, dass die Bildung des Mesoderms (Mesoblasts) nicht in
gleichem Masse im ganzen Umfange der Embryonalanlage vor sich geht, sondern dass letzteres
von vornherein in Form von zwei parallelen Streifen angelegt wird, die von einem gemeinsamen
Punkte, der früher am Hinterende befindlichen Keimstelle ausgehen und sich von dort allmählich
nach vorn hin ausdehnen, wobei sie sich auch nach vorn etwas verbreitern. Die charakteristische
Bildungsweise des Mesoderms in Form zweier Streifen ist namentlich in der vorderen Partie
der Embryonalanlage deutlich, weil dort die Verhältnisse wegen des Fehlens der medianen
von der Keimstelle nach vorn wandernden Mesodermzellen übersichtlicher und klarer liegen.
An Querschnittserien ist dort zu ersehen, dass der Bildungsmodus des Mesoderms durch die
Gestalt des Ektoderms innerhalb der Embryonalanlage bedingt wird (Fig. 32). Das Ektoderm
ist längs der Medianlinie am dünnsten und bleibt dort einschichtig, in den beiden Seitenteilen
dagegen findet eine lebhafte Vermehrung der Zellen statt, sodass das Ektoderm sich daselbst
verdickt, während es noch weiter lateralwärts in das wieder einschichtige Blastoderm (Ektoderm)
der dorsalen Fläche übergeht, welches natürlich nicht mehr zur eigentlichen Embryonalanlage
hinzugehört.
Die Abspaltung des Mesoderms geht nun fast ausschliesslich in den beiden verdickten
Lateralteilen vor sich. Hier findet eine lebhafte Immigration von Zellen statt, die, sobald sie
unter das Ektoderm gelangt sind, sich häufig wiederum teilen und damit ein schnelles Wachstum
des Mesoderms begünstigen. Im Ektoderm wird die Entstehung etwaiger, durch die Auswanderung
bedingter Defekte ebenfalls durch lebhafte Zellteilungen verhütet. Die Kernspindeln der Ektodermzellen
findet man hierbei mit ihren Längsachsen fast stets tangential gelagert (Fig. 32 kk).
Die Durchschnürung vollzieht sich dann also in radialer Richtung. Gelegentlich finden sich
aber auch fast radial stehende Kernspindeln, so dass damit das eine Teilungsprodukt wohl
zweifellos zu einer neuen Mesodermzelle wird, während das andere im Verbände des Ektoderms
verbleibt. Im letzteren Falle handelt es sich also um einen echten Delaminationsvorgang.
Bisweilen spalten sich in den Lateralteilen auch ganze Gruppen von 6 bis 8 Zellen ziemlich
gleichzeitig vom Ektoderm ab. Da die verdickten Lateralteile ziemlich breit sind, so können
an einem Querschnitt oft mehrere solcher Einwanderungsstellen getroffen werden.
Eine Einstülpung oder auch nur eine Rinnenbildung habe ich bei diesen Vorgängen aber
an keinem Punkte, weder lateral noch medial, weder in den vorderen noch in den hinteren
Teilen der Embryonalanlage nachweisen können. Wenn an Schnitten in der Körpermitte
gelegentlich eine Einfaltung oder schwache Einkrümmung zu sehen ist, so handelt es sich
hierbei lediglich um ein Kunstprodukt, welches bei unverletzten Eiern regelmässig vermisst wird.
Das Auftreten einer Rinne oder längsverlaufenden Einstülpung in der Medianlinie der
Embryonalanlage würde überdies vom mechanischen Standpunkte aus unverständlich sein, denn
Zoologien. Heft 33. 3