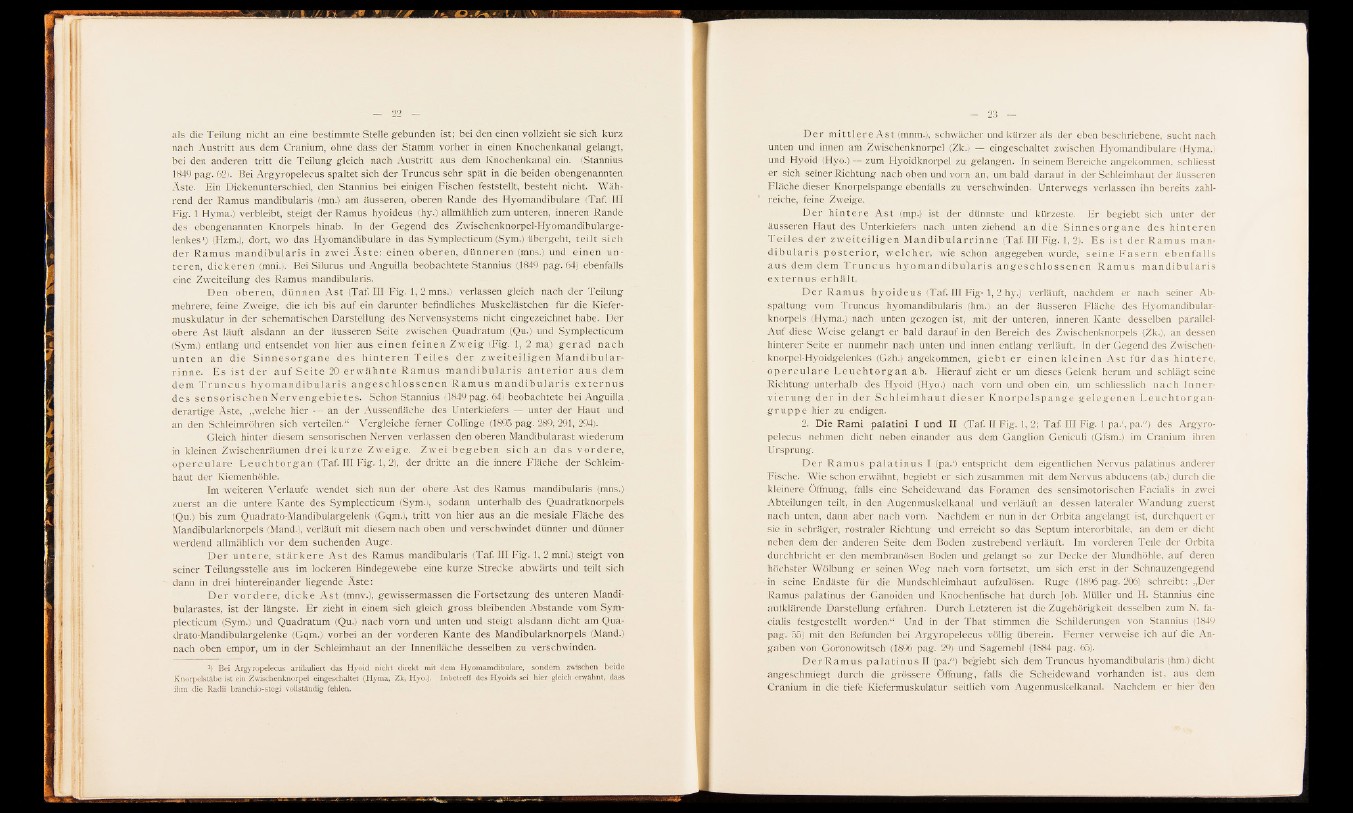
als die Teilung nicht an eine; bestimmte Stelle gebunden ist; bei den einen vollzieht sie sich kurz
nach Austritt aus dem Cranium, ohne dass der Stamm vorher in einen Knochenkanal gelangt,
bei den anderen tritt die Teilung gleich nach Austritt aus dem Knochenkanal ein. (Stannius
1849 pag. 62). Bei Argyropelecus spaltet sich der (Truncus sehr spät in die beiden obengenannten
Äste. Ein Dickenunterschied, den Stannius bei einigen Fischen feststellt, besteht nicht. Während
der Ramus mandibularis (mn.) am äusseren, oberen Rande des Hyomandibulare |pJaf. III
Fig. 1 Hyma.) verbleibt, steigt der Ramus hyoideus (hy(.) allmählich zum unteren, inneren Rande
des ebengenannten Knorpels hinab. In der Gegend des Zwischenknorpel-Hyomanäibülarge-
lenkes*) (Hzm.), dort, wo das Hyomandibulare in das Symplecticumgym.) übergeht, te ilt sich
d e r Ramus m a n d ib u la ris in zwei Ä s te : einen oberen, d ü n n e ren (mnsi)(und einen u n teren
, d ic k e r e s (mni.). Bei Silurus und Anguilla beobachtete Stannius (1849 pag. 6fc ebenfalls
eine Zweiteilung des Ramus mandibularis.
Den oberen, dünnen A s t (Taf. III Fig. 1, 2 mns.Jiiyerlassen gleich nach der Teilung
mehrere, feine Zweige, die ich bis auf ein darunter befindliches Muskelästchen für die Kiefermuskulatur
in der schematischen Darstellung des Nervensystems nicht eingezdehnet habe. Der
obere Ast läuft alsdann an der äusseren Seite zwischen Quadratum IQufi-uni SymÄcticum
(Sym.) entlang und entsendet von hier aus e in en fe in e n Zw e ig (Fig. 1, 2 ma) g e r a d n a ch
u n te n an die S in n e s o rg a n e d e s h in te r e n T eiles; d e r zw e ite ilig e n M a n d ib u la r rin
n e . E s ijMi d e r a u f S e it# p |§ e rw ä h n te R am u s m a n d ib u l a r i lä a n te r io r a u lto sm
dem T ru n c u s h y om a n d ib u la r is a n g e s c h lo s s e n e n R am u s m a n d ib u la r is e x te rn u s
de s s'ens;&ri||:hen N e rv en g e b ie te s :-’ Schon Stannius (1849 pag. 64) beobachtete, bei Anguilla
derartige Äste, „welche hier — an der Aussenfläche dß:rUnterideferjg|H unter der Haut und
an den Schleimröhren sich verteilen.“ Vergleiche ferner Collinge (-1895 pag. 289, 291, 294).
Gleich hinter diesem sensorischen Nerven verlassen d,en oberen Mandibularast wiederum
in kleinen Zwischenräumen d re i "k u rz e Zw e ig e . Zwei b e g e b e n s ie b an d a s v o rd e re ,
o p e r e u la r e L e u c h to rg a n (Taf. III Sig. i ,Ä der dritte an die innere Fläche der Schleimhaut
der Kiemenhöhle.
Im weiteren Verlaufe wendet sich nun der obere Ast des Ramus mandibularis (mns.)
zuerst an dih untere Kante des Symplecticum (Sym.)||iodann unterhalb äÄQuädratknorpels
(Qu.) bis zum Quadrato-MandibulargelenÄ i(Gqm.), tritt von hier aus an efe mesiafi' Fläche des
Mandibularknorpels (Mand.), verläuft mit diesem nach oben und verschwindet dünner und dünner
werdend allmählich'Vor dem suchenden Auge.
D e r u n te re , s t ä r k e r e A s t des Ramus mandibularis-(Taf. "iBiFig. l,v;| m ni.|steigt von
seiner Teilungsstelle aus im lockeren Bindegewebe eine kurze Strecke abwärts und teilt sich
dann in drei hintereinander liegende Äste:
D e r v o rd e re , d ic k e Ä s t (mnv.); gewissermassen die Fortsetzung des unteren Mandibularastes,
ist der längste. Er zieht in einem sich gleich gross bleibenden Abstande vom Symplecticum
(Sym.) und Quadratum (Qu.) nach vom und unten und steigt alsdann dicht am Qua-
drato-Mandibulargelenke (Gqm.) vorbei an der vorderen Kante des Mandibularknorpels (Mand.)
nach oben empor, um in der Schleimhaut an der Innenfläche desselben zu verschwinden.
x) Bei Argyropelecus artikuliert das Hyoid nicht direkt mit dem Hyomamdibulare, sondern zwischen beide
Knorpelstäbe ist ein Zwischenknorpel eingeschaltet (Hyma, Zk, Hyo.). . Inbetreff des Hyoids sei hier gleich erwähnt, dass
ihm die Radii branchio-stegi vollständig fehlen.
D e r m ittle r e A s t (mnm.), schwächer und kürzer als der eben beschriebene, sucht nach
unten und innen am Zwischenknorpel (Zk.) — eingeschaltet zwischen Hyomandibulare (Hyma.)
und Hyoid (Hyo.) — zum Hyoidknorpel zu gelangen. In seinem Bereiche angekommen, schliesst
er sich seiner Richtung nach oben und vorn an, um bald daraut in der Schleimhaut der äusseren
Fläche dieser Knorpelspange ebenfalls zu verschwinden. Unterwegs verlassen ihn bereits zahlreiche,
feine Zweige.
D e r h in te r e A s t (mp.) ist der dünnste und kürzeste. Er begiebt sich unter der
äusseren Haut des Unterkiefers nach unten ziehend an die S in n e so rg a n e des h in te re n
T e ile s d e r zw e ite ilig e n M a n d ib u la rrin n e (Taf. III Fig. 1, 2). E s i s t d e r R am u s m an d
ib u la r is p o s te r io r , w e lch e r, wie schon angegeben wurde, s e in e F a s e r n e b e n fa lls
a u s dem dem T ru n c u s h y om a n d ib u la r is a n g e s c h lo s s e n e n R am u s m a n d ib u la r is
e x te rn u s e rh ä lt.
> D e r R am u s h y o id e u s (Taf. III Fig*1, 2 hy.) verläuft, nachdem er nach seiner Abspaltung
vom Truncus .hyomandibularis (hm.) an der äusseren Fläche des Hyomandibular-
knorpels (Hyma.) nach unten gezogen ist, mit der unteren, inneren Kante desselben parallel-
Auf diese Weise gelangt er bald darauf in den Bereich des Zwischenknorpels (Zk.), an dessen
hinterer Seite er nunmehr nach unten und innen entlang verläuft. In der Gegend des Zwischen-
knorpel-Hyoidgelenkes (Gzh.) angekommen, g ie b t e r e in en k le in e n A s t fü r d a s h in te re ,
o p e r e u la r e L e u c h to r g a n ab. Hierauf zieht er um dieses Gelenk herum und schlägt seine
Richtung unterhalb des Hyoid (Hyo.) nach vorn und oben ein, um schliesslich n a ch In n e rv
ie r u n g d e r in d e r S c h le im h a u t d ie s e r K n o rp e lsp a n g e g e le g e n e n L e u c h to rg a n g
ru p p e hier zu endigen.
2. Die Rami palatini I und II (Taf. II Fig. 1, 2; Taf. III Fig. 1 pa/, pa.") des Argyropelecus
nehmen dicht neben einander aus dem Ganglion Geniculi (Gfsm.) im Cranium ihren
Ursprung.
D e r R am u s p a la t in u s I (pa/) entspricht dem eigentlichen Nervus palatinus anderer
Fische. Wie schon erwähnt, begiebt er sich zusammen mit dem Nervus abducens (ab.) durch die
kleinere Öffnung, falls eine Scheidewand das Foramen des sensimotorischen Facialis in zwei
Abteilungen teilt, in den Augenmuskelkanal und verläuft an dessen lateraler Wandung zuerst
nach unten, dann aber nach vorn. Nachdem er nun in der Orbita an gelangt ist, durchquert er
sie in schräger, rostraler Richtung und erreicht so das Septum interorbitale, an dem er dicht
neben dem der anderen Seite dem Boden zustrebend verläuft. Im vorderen Teile der Orbita
durchbricht er den membranösen Boden und gelangt so zur Decke der Mundhöhle, auf deren
höchster Wölbung er seinen Weg nach vorn fortsetzt, um sich erst in der Schnauzengegend
in seine Endäste für die Mundschleimhaut aufzulösen. Rüge (1896 pag. 206) schreibt: „Der
Ramus palatinus der Ganoiden und Knochenfische hat durch Joh. Müller und H. Stannius eine
aulklärende Darstellung erfahren. Durch Letzteren ist die Zugehörigkeit desselben zum N. facialis
festgestellt worden.“ Und in der That stimmen die Schilderungen von Stannius (1849
pag. 55) mit den Befunden bei Argyropelecus völlig überein. Ferner verweise ich auf die Angaben
von Goronowitsch (1896 pag. 29) und Sagemehl (1884 pag. 65).
D e r R am u s p a la tin u s II (pa.") begiebt sich dem Truncus hyomandibularis (hm.) dicht
angeschmiegt durch die grössere Öffnung, falls die Scheidewand vorhanden ist, aus dem
Cranium in die tiefe Kiefermuskulatur seitlich vom Augenmuskelkanal. Nachdem er hier ‘den