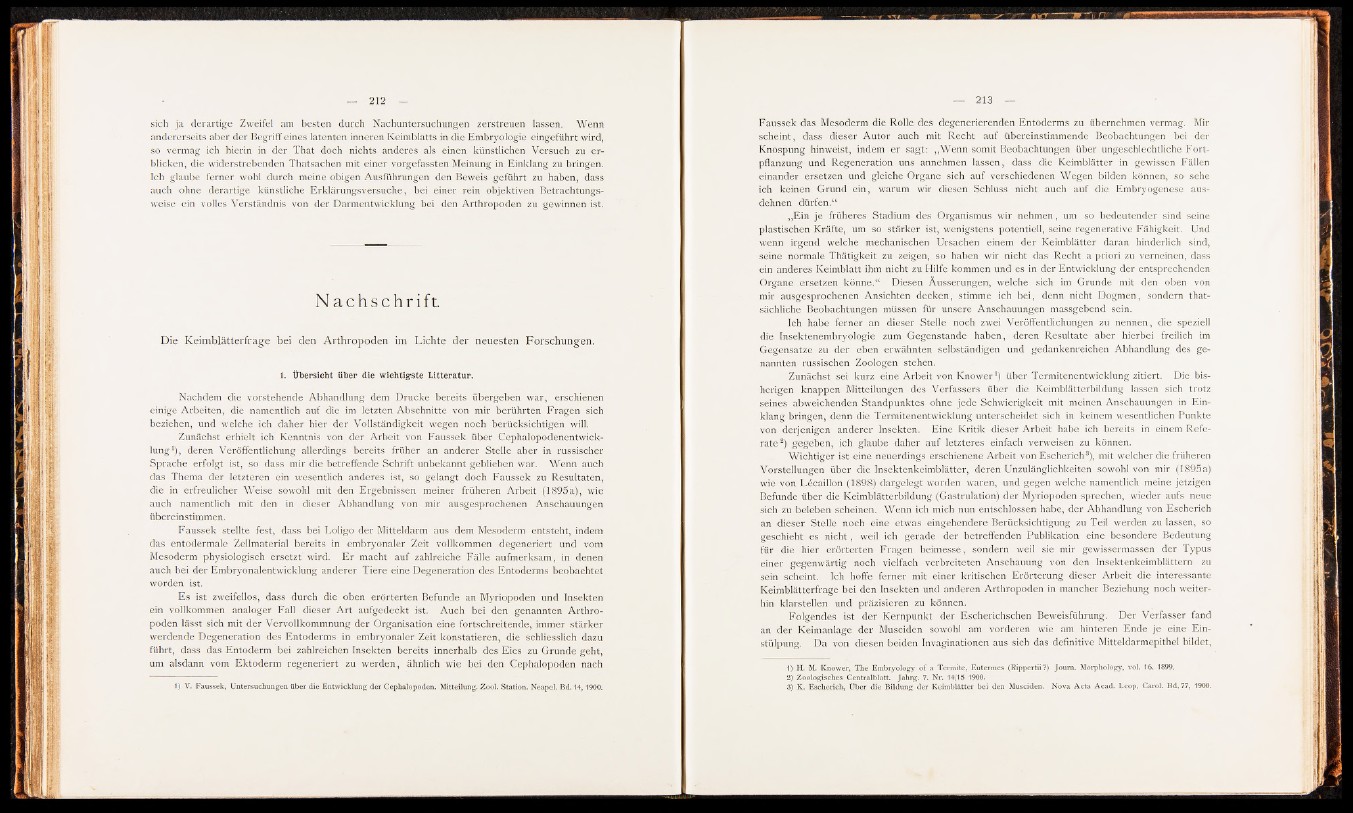
sich ja derartige Zweifel am besten durch Nachuntersuchungen zerstreuen lassen. Wenn
andererseits aber der Begriff eines latenten inneren Keimblatts in die Embryologie eingeführt wird,
so vermag ich hierin in der That doch nichts anderes als einen künstlichen Versuch zu erblicken,
die widerstrebenden Thatsachen mit einer vorgefassten Meinung in Einklang zu bringen.
Ich glaube ferner wohl durch meine obigen Ausführungen den Beweis geführt zu haben, dass
auch ohne derartige künstliche Erklärungsversuche, bei einer rein objektiven Betrachtungsweise
ein volles Verständnis von der Darmentwicklung bei den Arthropoden zu gewinnen ist.
Na c h s c h r i f t .
Die Keimblätterfrage bei den Arthropoden im Lichte der neuesten Forschungen.
1. Übersicht über die wichtigste Litteratur.
Nachdem die vorstehende Abhandlung dem Drucke bereits übergeben war, erschienen
einige Arbeiten, die namentlich auf die im letzten Abschnitte von mir berührten Fragen sich
beziehen, und welche ich daher hier der Vollständigkeit wegen noch berücksichtigen will.
Zunächst erhielt ich Kenntnis von der Arbeit von Faussek über Cephalopodenentwick-
lung1), deren Veröffentlichung allerdings bereits früher an anderer Stelle aber in russischer
Sprache erfolgt ist, so dass mir die betreffende Schrift unbekannt geblieben war. Wenn auch
das Thema der letzteren ein wesentlich anderes ist, so gelangt doch Faussek zu Resultaten,
die in erfreulicher Weise sowohl mit den Ergebnissen meiner früheren Arbeit (1895a), wie
auch namentlich mit den in dieser Abhandlung von mir ausgesprochenen Anschauungen
übereinstimmen.
Faussek stellte fest, dass bei Loligo der Mitteldarm aus dem Mesoderm entsteht, indem
das entodermale Zellmaterial bereits in embryonaler Zeit vollkommen degeneriert und vom
Mesoderm physiologisch ersetzt wird. Er macht auf zahlreiche Fälle aufmerksam, in denen
auch bei der Embryonalentwicklung anderer Tiere eine Degeneration des Entoderms beobachtet
worden ist.
Es ist zweifellos, dass durch die oben erörterten Befunde an Myriopoden und Insekten
ein vollkommen analoger Fall dieser Art aufgedeckt ist. Auch bei den genannten Arthropoden
lässt sich mit der Vervollkommnung der Organisation eine fortschreitende, immer stärker
werdende Degeneration des Entoderms in embryonaler Zeit konstatieren, die schliesslich dazu
führt, dass das Entoderm bei zahlreichen Insekten bereits innerhalb des Eies zu Grunde geht,
um alsdann vom Ektoderm regeneriert zu werden, ähnlich wie bei den Cephalopoden nach
1) V. Faussek, Untersuchungen über die Entwicklung der Cephalopoden. Mitteilung. Zool. Station. Neapel. Bd. 14,1900.
Faussek das Mesoderm die Rolle des degenerierenden Entoderms zu übernehmen vermag. Mir
scheint, dass dieser Autoft auch mit Recht auf übereinstimmende Beobachtungen bei der
Knospung hinweist, indem er sagt: ,,Wenn somit Beobachtungen über ungeschlechtliche Fortpflanzung
und Regeneration uns annehmen lassen, dass die Keimblätter in gewissen Fällen
einander ersetzen und gleiche Organe sich auf verschiedenen Wegen bilden können, so sehe
ich keinen Grund ein, warum wir diesen Schluss nicht auch auf die Embryogenese ausdehnen
dürfen.“
„Ein je früheres Stadium des Organismus wir nehmen, um so bedeutender sind seine
plastischen Kräfte, um so stärker ist, wenigstens potentiell, seine regenerative Fähigkeit. Und
wenn irgend welche mechanischen Ursachen einem der Keimblätter daran hinderlich sind,
seine normale Thätigkeit zu zeigen, so haben wir nicht das Recht a priori zu verneinen, dass
ein anderes Keimblatt ihm nicht zu Hilfe kommen und es in der Entwicklung der entsprechenden
Organe ersetzen könne.“ Diesen Äusserungen, welche sich im Grunde mit den oben von
mir ausgesprochenen Ansichten decken, stimme ich bei, denn nicht Dogmen, sondern that-
sächliche Beobachtungen müssen für unsere Anschauungen massgebend sein.
Ich habe ferner an dieser Stelle noch zwei Veröffentlichungen zu nennen, die speziell
die Insektenembryologie zum Gegenstände haben, deren Resultate aber hierbei freilich im
Gegensätze zu der eben erwähnten selbständigen und gedankenreichen Abhandlung des genannten
russischen Zoologen stehen.
Zunächst sei kurz eine Arbeit von Knower1) über Termitenentwicklung zitiert. Die bisherigen
knappen Mitteilungen des Verfassers über die Keimblätterbildung lassen sich trotz
seines abweichenden Standpunktes ohne jede Schwierigkeit mit meinen Anschauungen in Einklang
bringen, denn die Termitenentwicklung unterscheidet sich in keinem wesentlichen Punkte
von derjenigen anderer Insekten. Eine Kritik dieser Arbeit habe ich bereits in einem Refera
te2) gegeben, ich glaube daher auf letzteres einfach verweisen zu können.
Wichtiger ist eine neuerdings erschienene Arbeit von Escherich3), mit welcher die früheren
Vorstellungen über die Insektenkeimblätter, deren Unzulänglichkeiten sowohl von mir (1895a)
wie von Lecaillon (1898) dargelegt worden waren, und gegen welche namentlich meine jetzigen
Befunde über die Keimblätterbildung (Gastrulation) der Myriopoden sprechen, wieder aufs neue
sich zu beleben scheinen. Wenn ich mich nun entschlossen habe, der Abhandlung von Escherich
an dieser Stelle noch eine etwas eingehendere Berücksichtigung zu Teil werden zu lassen, so
geschieht es nicht, weil ich gerade der betreffenden Publikation eine besondere Bedeutung
für die hier erörterten Fragen beimesse, sondern weil sie mir gewissermassen der Typus
einer gegenwärtig noch vielfach verbreiteten Anschauung von den Insektenkeimblättern zu
sein scheint. Ich hoffe ferner mit einer kritischen Erörterung dieser Arbeit die interessante
Keimblätterfrage bei den Insekten und anderen Arthropoden in mancher Beziehung noch weiterhin
klarstellen und präzisieren zu können.
Folgendes ist der Kernpunkt der Escherichschen Beweisführung. Der Verfasser fand
an der Keimanlage der Musciden sowohl am vorderen wie am hinteren Ende je eine Einstülpung.
Da von diesen beiden Invaginationen aus sich das definitive Mitteldarmepithel bildet,
1) H. M. Knower, The Embryology of a Termite, Eutermes (Rippertii?) Journ. Morphology, vol. 16. 1899.
2) Zoologisches Centralblatt. Jahrg. 7. Nr. 14/15 1900.
3) K. Escherich, Über die Bildung der Keimblätter bei den Musciden. Nova Acta Acad. Leop. Carol. Bd. 77, 1900.