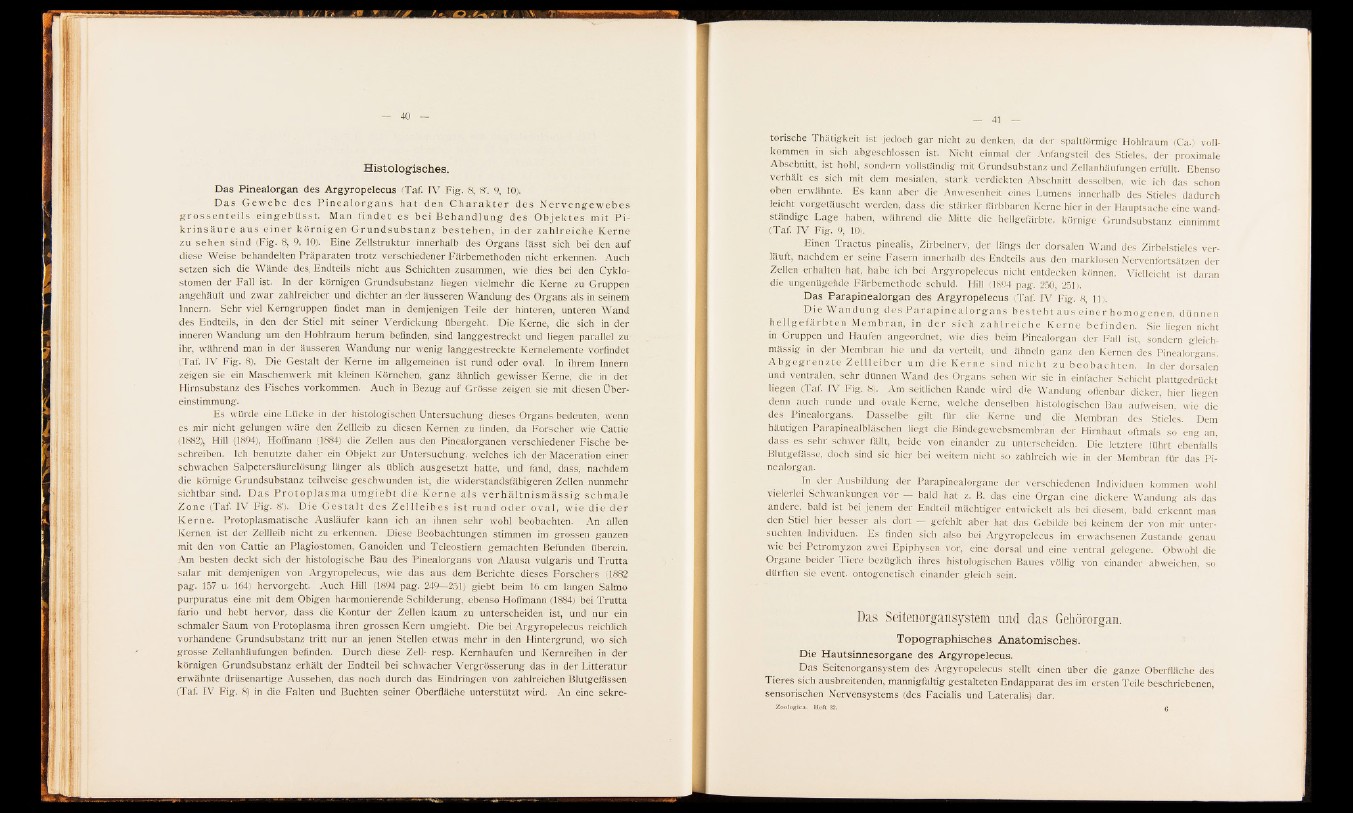
Histologisches.
Das Pinealorgan des Argyropelecus (Taf. IV Fig. 8, 8*. 9, 10).
D a s G ew e b e d e s P in e a lo r g a n s h a t den C h a r a k t e r d e s N e rv e n g ew e b e s
g r o s s e n t e il s e in g e b ü s s t. Man f in d e t e^'-bei B e h a n d lu n g d e s O b je k te s m it P i k
r in s ä u r e a u s e in e r k ö rn ig e n G r u n f ^ u b s ta n z b e s te h e n , in d e r z a h lre ic h e Kerne
zu sehen sind (Fig. 8, 9, 10). Eine Zellstruktur innerhalb des Organs lässt sich bei den auf
diese Weise behandelten Präparaten trotz verschiedener Färbemethoden nicht erkennen. Auch
setzen sich die Wände ‘des. Endteils nicht aus Schichten zusammen, wie d i | | bei den Cyklo-
stomen der Fall ist. In der körnigen Grundsubstanz liegen vielmehr die Kerne zu Gruppen
angehäuft und zwar zahlreicher und dichter an der äusseren Wandung dès Organs als in seinem
Innern. Sehr viel Kemgruppen findet man in demjenigen Teile der hinteren, unteren Wand
des Endteils, in den der Stiel mit seiner Verdickung übergeht. Die Kerne, die sich in der
inneren Wandung um den Höhlraum herum befinden, sind langgestreckt und liegen parallel?zu-
ihr, während man in der äusseren Wandung nur wenig langgestreckte Kernelemente vorfindet
(Taf. IV Fig. 8). Die Gestalt der Kerne im allgemeinen ist rund oder oval. In ihrem Innern
zeigen sie ein Maschenwerk mit kleinen Körnchen, ganz ähnlich gewisser Korne, d'iè ‘ in der
Himsubstanz des Fisches Vorkommen. Auch in Bezug auf Grösse zeigen sie mit diesèn Üben
einstimmung.
Es würde eine Lücke in der histologischen Untersuchung dieses. Organs bedeuten, wenn
es mir nicht gelungen wäre den Zellleib zu diesen Kernen zu finden, da Forscher wie Cattie
(1882), Hill (1894), Hoffmann (1884) die Zellen aus den Pinealorganen verschiedener Fische beschreiben.
Ich benutzte daher ein Objekt zur Untersuchung, welches ich der Macération einer
schwachen Salpetersäurelösung länger als üblich ausgesetzt hatte, und fand, dass, nachdem
die körnige Grundsubstanz teilweise geschwunden ist, die widerstandsfähigeren Zellen nunmehr
sichtbar sind. D a s P r o to p la sm a um g ie b t d ie K e rn e a ls v e r h ä ltn ism ä s s ig schm ale
Z o n e (Taf. IV Fig. 8>).- Die G e s ta lt d e s Z e llle ib e s is t rund o d e r o v aM w ie die d e r
K e rn e . Protoplasmatische Ausläufer kann ich an ihnen sehr wohl beobachten. An allen
Kernen ist der Zellleib nicht zu erkennen. Diese Beobachtungen stimmen im. grïiS.sen ganzen
mit den von Cattie an Plagiostomen, Ganoiden und Teleostiern gemachten Befunden überein.
Am besten deckt sich der. histologische Bau des Pinealorgans von Alausä vulgaris und Trutta
salar mit demjenigen von Argyropelecus, wie das aus dem Berichte dieses Forschers (1882
pag. 157 u. 164) hervorgeht. Auch Hill (1894 pag. 249 - -251 ) giebt beim 16 cm langen Salmo
purpuratus eine mit dem Obigen harmonierende Schilderung, ebenso Hoffmann (1884); bei Trutta
fario und hebt hervor, dass die Kontur der Zellen kaum zu unterscheiden ist, und nur ein
schmaler Saum von Protoplasma ihren grossen Kern umgiebt. Die bei Argyropelecus reichlich
vorhandene Grundsubstanz tritt nur an jenen Stellen etwas mehr in den Hintergrund, wo sich
grosse Zellanhäufungen befinden. Durch diese Zell- resp. Kemhaufen und Kemreihen in der
körnigen Grundsubstanz erhält der Endteil bei schwacher Vergrösserung das in der Litteratur
erwähnte drüsenartige Aussehen, das noch durch das Eindringen von zahlreichen Blutgefässen
(Taf. IV Fig. 8) in die Falten und Buchten seiner Oberfläche unterstützt wird. An eine sekres
torische Thätigkeit ist jedoch gar nicht zu denken, da der spaltförmige Hohlraum (Ca.) vollkommen
in sich abgeschlossen ist. Nicht einmal der Anfangsteil des Stieles, der proximale
Abschnitt, ist hohl, jsbndern vollständig mit Grundsubstanz und Zellanhäufungen erfüllt. Ebenso
verhält es sich mit dem mesialen, stark Verdickten Abschnitt desselben, wie ich das schon
oben erwähnte. Es kann aber die Anwesenheit eines Lumens innerhalb des Stieles dadurch
leicht vorgetäuscht werden, dass die stärker filrbbaren Kerne hier in der Hauptsache eine wandständige
Lage haben, während die Mitte die hellgefärbte, körnige Grundsubstanz einnimmt
(Taf. IV Fig. 9, 10)E*i
Einen Tractus pineali^, Zirbelnerv, der längs der dorsalen Wand des Zirbelstieles verläuft,
nachdem er seine Fasern innerhalb des Endteils aus den marklosen Nervenfortsätzen der
Zellen erhalten hat, habe ich bei Argyropelecus nicht entdecken können. Vielleicht ist daran
die ungenügende: Färbemethpde schuld. Hill (igfiSpag. 250, 251¿r-Ä
Das Parapinealorgan des Argyropelecus Q/af IV Fig. 8, 11):
Die W a n d u n g d J jP a r a p in e a lo r g a n S b e s te h t a u s e in e r h omogenen, d ü n n en
h e llg e f ä r b te n Membran, in d e r s ic h z a h lr e ic h e Ke rn e, b e fin d en . Sie liegen nicht
in Gruppen und Haufen angeordnet, wie dies , beim Pinealorgan . der Fall ist, sondern gleichmassig
in der Membran hie u n d ^ ä verteilt, und ähneln iÄ n z den Kernen des Pinealorgans.
A b g e g r e n z te Z e llle ib e r um die K e rn e sind n ic h t zu b e o b a c h te n . In der dorsalen
und ventralen, sehr dünnen Wand des Organs sahen wir sie in einfacher Schicht plattgedrüekt
liegenj^Taf IV Fig. 8)^ Am seitlichen Rande wird die Wandung offenbar dicker, hier liegen
denn auch runde und ovale Kerne, welche denselben histologischen Bau aufweisen, wie die
des Pinealorgans. Dasselbe gilt für die Kerne und die Membran des Stieles. Dem
häutigen Parapbealbläschen liegt die Bindegewebsmembran der Hirnhaut . oftmals so eng an,
dass es sehr schwer fällt, beide von einander zu unterscheiden, wäpie, letztere führt ebenfalls
Blutgefässe, doch sind sie hier bei weitem nichfifso, zahlreich wie in der Membran für das Pi-
nealorgan.
In dei Ausbildung der Parapinealorgane der verschiedenen Individuen kommen wohl
vielerlei Schwankungen vor — bald hat z. B. das eine Organ eine dickere Wandung als das
andere, bald ist bei jenem der Endteil mächtiger entwickelt als bei diesem, bald erkennt man
den Stiel hier besser als dort | | | gefehlt aber hat das Gebilde bei keinem der von mir untersuchten
Individuen. Es finden sich also bei Argyropelecus im erwachsenen Zustande genau
wie bei Petromyzon zwei Epiphysen vor, eine dorsal und eine ventral gelegene. Obwohl die
Organe beider Tiere bezüglich ihres histologischen Baues völlig von einander ab weichen, so
dürften sie event. ontogenetisch einander gleich sein.
Das Seitenorgansystem und das Gehörorgan.
Topographisches Anatomisches.
Die Hautsinnesorgane des Argyropelecus.
Das Seitenorgansystem dés Argyropelecus stellt einen über die ganze Oberfläche des
Tieres sich ausbreitenden, mannigfaltig gestalteten Endapparat des im ersten Teile beschriebenen,
sensorischen Nervensystems (des Facialis und Lateralis) dar.
Zoologica. Heft 32. g