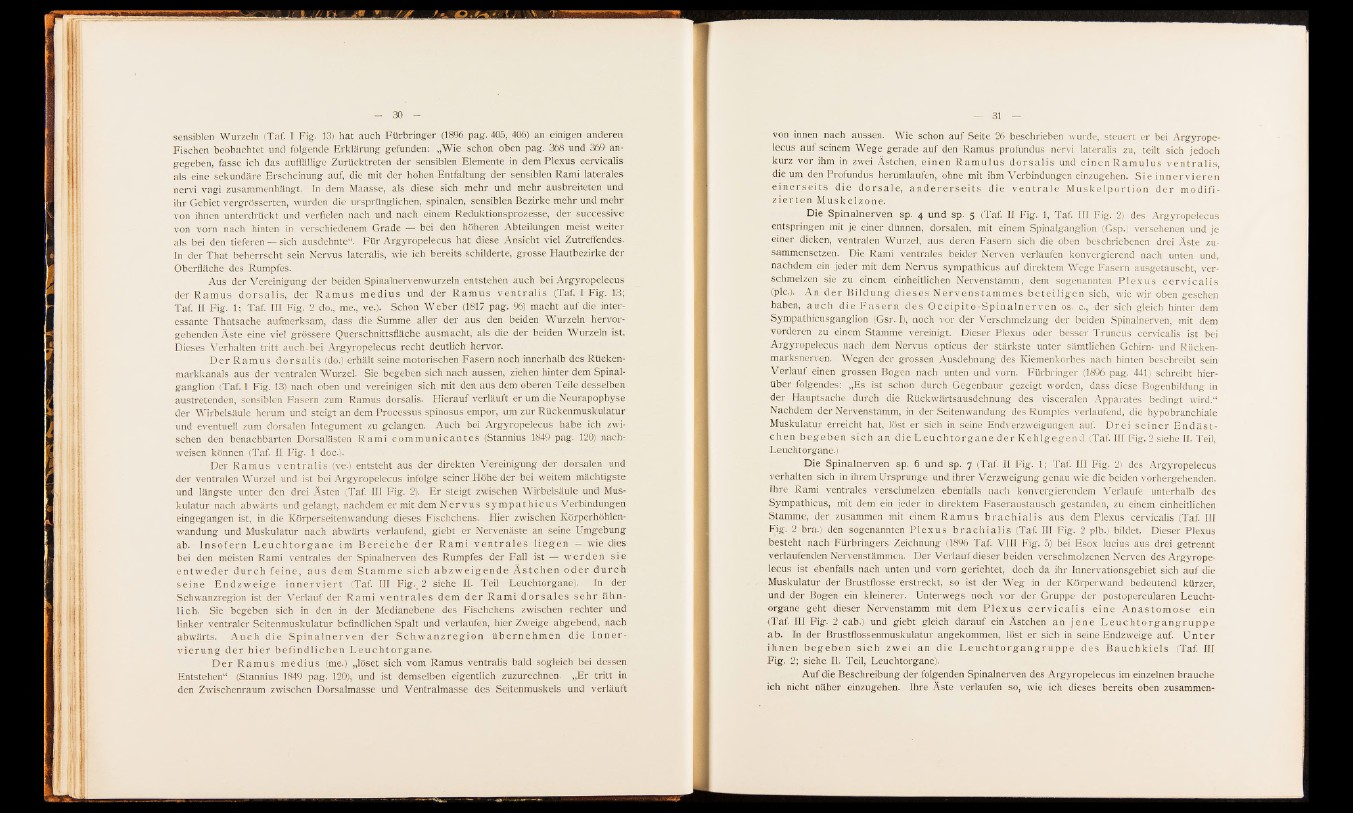
sensiblen Wurzeln (Taf. I Fig. 13) hat auch Fürbringer (1896 pag. 405, 406) an einigen anderen
Fischen beobachtet und folgende Erklärung gefunden: „Wie schon oben pag. 368 und 369 angegeben,
fasse ich das auffällige Zurücktreten der sensiblen Elemente in dem Plexus cervicalis
als eine sekundäre Erscheinung auf, die mit der hohen Entfaltung der sensiblen Rami laterales
nervi vagi zusammenhängt. In dem Maasse, als diese sich mehr und mehr ausbreiteten und
ihr Gebiet vergrösserten, wurden die ursprünglichen, spinalen, sensiblen Bezirke mehr und mehr
von ihnen unterdrückt und verfielen nach und nach einem Reduktionsprozesse, der successive
von vorn nach hinten in verschiedenem Grade — bei den höheren Abteilungen meist weiter
als bei den tieferen — sich ausdehnte“. Für Argyropelecus hat diese Ansicht viel Zutreffendes.
In der That beherrscht sein Nervus lateralis, wie ich bereits schilderte, grosse Hautbezirke der
Oberfläche des Rumpfes.
Aus der Vereinigung der beiden Spinalnervenwurzeln entstehen auch bei Argyropelecus
der R am u s d o r s a lis , der R am u s m e d iu s und der R am u s v e n tr a lis (Taf. I Fig. 13;
Taf. II Figvj$|Taf. III Fig. 2 do., me., ve.)/ Schon Weber (1817 pag. 96) macht auf die interessante
Thatsache aufmerksam, dass die Summe aller der aus den beiden Wurzeln hervorgehenden
Äste eine viel grössere Querschnittsfläche ausmacht, als die der beiden Wurzeln ist.
Dieses Verhalten tritt auch-bei Argyropelecus recht deutlich hervor.
D e r R am u s d o r s a lis (do.) erhält seine motorischen Fasern noch innerhalb des Rückenmarkkanals
aus der ventralen Wurzel. Sie begeben sich nach aussen, ziehen hinter dem Spinalganglion
(Taf. 1 Fig. 13) nach oben und vereinigen sich mit den aus dem oberen Teile desselben
austretenden, sensiblen Fasern zum Ramus dorsalis. Hierauf verläuft er um die Neurapophyse
der Wirbelsäule herum und steigt an dem Processus spinosus empor, um zur Rückenmuskulatur
und eventuell zum dorsalen Integument zu gelangen. Auch bei Argyropelecus habe ich zwischen
den benachbarten Dorsalästen R am i c om m u n ic a n te s (Stannius 1849 pag. 120) nach-
weisen können (Taf. II Fig. 1 doc.).
Der R am u s v e n tr a li s (ve.) entsteht aus der direkten Vereinigung der dorsalen und
der ventralen Wurzel und ist bei Argyropelecus infolge seiner Höhe der bei weitem mächtigste
und längste unter den drei Ästen (Taf. III Fig. 2). Er steigt zwischen Wirbelsäule und Muskulatur
nach abwärts und gelangt, nachdem er mit dem N e rv u s s ym p a th ic u s Verbindungen
eingegangen ist, in die Körperseitenwandung dieses Fischchens. Hier zwischen Körperhöhlenwandung
und Muskulatur nach abwärts verlaufend, giebt er Nervenäste an seine Umgebung
ab. In so f e rn L e u c h to r g a n e im B e re ic h e d e r R am i v e n tr a le s lie g e n B wie dies
bei den meisten Rami ventrales der Spinalnerven des Rumpfes der Fall ist — w e rd e n s ie
e n tw e d e r d u r c h fe in e , a u s dem S tam m e s ic h a b zw e ig e n d e Ä s tc h e n o d e r d u r c h
s e in e E n d zw e ig e in n e r v ie r t (Taf. III Fig.^ 2 siehe II. Teil Leuchtorgane). In der
Schwanzregion ist der Verlauf der R am i v e n tr a le s dem d e r R am i d o r s a le s s e h r ä h n lich.
Sie begeben sich in den in der Medianebene des Fischchens zwischen rechter und
linker ventraler Seitenmuskulatur befindlichen Spalt und verlaufen, hier Zweige abgebend, nach
abwärts. A u ch die S p in a ln e rv e n d e r S c hw a n z r e g io n ü b e rn e hm e n die I n n e r v
ie ru n g d e r h ie r b e fin d lic h e n L e u c h to rg a n e .
D e r R am u s m ed iu s (me.) „löset sich vom Ramus ventralis bald sogleich bei dessen
Entstehen“ (Stannius 1849 pag. 120), und ist demselben eigentlich zuzurechnen. „Er tritt in
den Zwischenraum zwischen Dorsalmasse und Ventralmasse des Seitenmuskels und verläuft
von innen nach aussen. Wie schon auf Seite 26 beschrieben wurde,. steuert er bei Argyropelecus
auf seinem Wege gerade auf den Ramus profundus nervi lateralis zu, teilt sich jedoch
kurz vor ihm in zwei Ästchen, e in en R am u lu s d o r s a lis und e in e n R am u lu s v e n tr a lis ,
die um den Profundus herumlaufen, ohne mit ihm Verbindungen einzugehen. Sie in n e rv ie r e n
e in e r s e it s die d o rs a le , a n d e r e r s e it s die v e n tr a le M u s k e lp o rtio n d e r m o d ifiz
ie r te n M u sk elzo n e.
Die Spinalnerven sp. 4 und sp. 5 (Taf. II Fig. 1, Taf. III Fig. 2) des Argyropelecus
entspringen mit je einer dünnen, dorsalen, mit einem Spinalganglion (Gsp.) versehenen und je
einer dicken, ventralen Wurzel, aus deren Fasern sich die oben beschriebenen drei Äste zusammensetzen.
Die Rami ventrales beider Nerven verlaufen konvergierend nach unten und,
nachdem ein jeder mit dem Nervus sympathicus auf direktem Wege Fasern ausgetauscht, verschmelzen
sie zu einem einheitlichen Nervenstamm, dem sogenannten P le x u s c e rv ic a lis
(Plc.). An d e r B ild u n g d ie s e s N e rv e n s tam m e s b e te ilig e n sich, wie wir oben gesehen
haben, a u c h die F a s e r n d e s O c c ip ito -S p in a ln e rv e n os. c., der sich gleich hinter dem
Sympathicusganglion (Gsr. I), noch vor der Verschmelzung der beiden Spinalnerven, mit dem
vorderen zu einem Stamme vereinigt. Dieser Plexus oder besser Truncus cervicalis ist bei
Argyropelecus nach dem Nervus opticus der stärkste unter sämtlichen Gehirn- und Rückenmarksnerven.
Wegen der grossen Ausdehnung des Kiemenkorbes nach hinten beschreibt sein
Verlauf einen grossen Bogen nach unten und vorn. Fürbringer (1896 pag. 441) schreibt hierüber
folgendes: „Es ist schon durch Gegenbaur gezeigt worden, dass diese Bogenbildung in
der Hauptsache durch die Rückwärtsausdehnung des visceralen Apparates bedingt wird.“
Nachdem der Nervenstamm, in der Seitenwandung des Rumpfes verlaufend, die hypobranchiale
Muskulatur erreicht hat, löst er sich in seine Endverzweigungen auf. D re i s e in e r E n d ä s t c
h en b e g e b e n s ic h an die L e u c h to rg a n e d e r K e h lg e g e n d (Taf. III Fig. 2 siehe II. Teil,
Leuchtorgane.)
Die Spinalnerven sp. 6 und sp. 7 (Taf. II Fig. 1; Taf. III Fig. 2) des Argyropelecus
yerhalten sich in ihrem Ursprünge und ihrer Verzweigung genau wie die beiden vorhergehenden.
Ihre Rami ventrales verschmelzen ebenfalls nach konvergierendem Verlaufe unterhalb des
Sympathicus, mit dem ein jeder in direktem Faseraustausch gestanden, zu einem einheitlichen
Stamme, der zusammen mit einem R am u s b r a c h i a l i s aus dem Plexus cervicalis (Taf. III
Fig. 2 bra.) den sogenannten PI ex us b r a c h i a l i s (Taf. III Fig. 2 plb.) bildet. Dieser Plexus
besteht nach Fürbringers Zeichnung (1896 Taf. VIII Fig. 5) bei Esox lucius aus drei getrennt
verlaufenden Nervenstämmen. Der Verlauf dieser beiden verschmolzenen Nerven des Argyropelecus
ist ebenfalls nach unten und vorn gerichtet, doch da ihr Innervationsgebiet sich auf die
Muskulatur der Brustflosse erstreckt, so ist der Weg in der Körperwand bedeutend kürzer,
und der Bogen ein kleinerer.: Unterwegs noch vor der Gruppe der postopercularen Leuchtorgane
geht dieser Nervenstamm mit dem P le x u s c e r v i c a l is ein e A n a s tom o s e ein
(Taf. III Fig. 2 cab.) und giebt gleich darauf ein Ästchen an je n e L e u c h to r g a n g r u p p e
ab. In der Brustflossenmuskulatur angekommen, löst er sich in seine Endzweige auf. U n te r
ih n en b e g e b e n s ic h zwei an die L e u c h to r g a n g r u p p e d e s B a u c h k ie ls (Taf. III
Fig. 2; siehe II. Teil, Leuchtorgane).
Auf die Beschreibung der folgenden Spinalnerven des Argyropelecus im einzelnen brauche
ich nicht näher einzugehen. Ihre Äste verlaufen so, wie ich dieses bereits oben zusammen