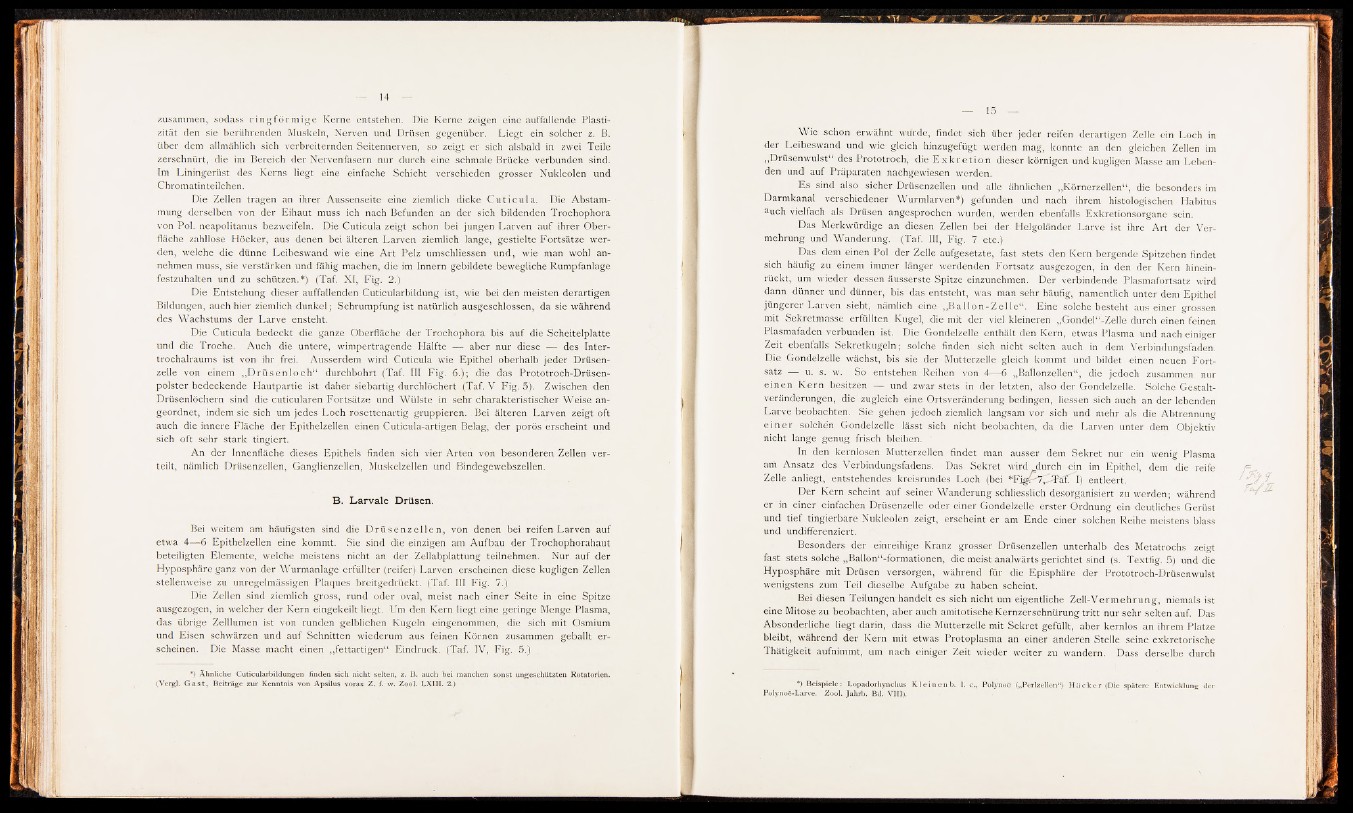
zusammen, sodass r in g fö rm ig e Kerne entstehen. Die Kerne zeigen eine auffallende Plastizität
den sie berührenden Muskeln, Nerven und Drüsen gegenüber. Liegt ein solcher z. B.
über dem allmählich sich verbreiternden Seitennerven, so zeigt er sich alsbald in zwei Teile
zerschnlirt, die im Bereich der Nervenfasern nur durch eine schmale Brücke verbunden sind.
Im Liningerüst des Kerns liegt eine einfache Schicht verschieden grösser Nukleolen und
Chromatinteilchen.
Die Zellen tragen an ihrer Aussenseite eine ziemlich dicke C u tic u la . Die Abstammung
derselben von der Eihaut muss ich nach Befunden an der sich bildenden Trochophora
von Pol. neapolitanus bezweifeln. Die Cuticula zeigt schon bei jungen Larven auf ihrer Oberfläche
zahllose Höcker, aus denen bei älteren Larven ziemlich lange, gestielte Fortsätze werden,
welche die dünne Leibeswand wie eine Art Pelz umschliessen und, wie man wohl annehmen
muss, sie verstärken und fähig machen, die im Innern gebildete bewegliche Rumpfanlage
festzuhalten und zu schützen.*) (Taf. XI, Fig. 2.)
Die Entstehung dieser auffallenden Cuticularbildung ist, wie bei den meisten derartigen
Bildungen, auch hier ziemlich dunkel; Schrumpfung ist natürlich ausgeschlossen, da sie während
des Wachstums der Larve ensteht.
Die Cuticula bedeckt die ganze Oberfläche der Trochophora bis auf die Scheitelplatte
und die Troche. Auch die untere, wimpertragende Hälftepigpaber nur diese — des Inter-
trochalraums ist von ihr frei. Ausserdem wird Cuticula wie Epithel oberhalb jeder Drüsenzelle
von einem „D rü s e n lo c h “ durchbohrt (Taf. III Fig. 6.); die das Prototroch-Drüsen-
polster bedeckende Hautpartie ist daher siebartig durchlöchert (Taf. V Fig. 5). Zwischen den
Drüsenlöchern sind die cuticularen Fortsätze und Wülste in sehr charakteristischer Weise angeordnet,
indem sie sich um jedes Loch rosettenartig gruppieren. Bei älteren Larven zeigt oft
auch die innere Fläche der Epithelzellen einen Cuticula-artigen Belag, der porös erscheint und
sich oft sehr stark tingiert.
An der Innenfläche dieses Epithels finden sich vier Arten von besonderen Zellen verteilt,
nämlich Drüsenzellen, Ganglienzellen, Muskelzellen und Bindegewebszellen.
B. Larvale Drüsen.
Bei weitem am häufigsten sind die D rü s e n z e lle n , von denen bei reifen Larven auf
etwa 4—6 Epithelzellen eine kommt. Sie sind die einzigen am Aufbau der Trochophorahaut
beteiligten Elemente, welche meistens nicht an der Zellabplattung teilnehmen. Nur auf der
Hyposphäre ganz von der Wurmanlage erfüllter (reifer) Larven erscheinen diese kugligen Zellen
stellenweise zu unregelmässigen Plaques breitgedrückt. (Taf. III Fig. 7.)
Die Zellen sind ziemlich gross, rund oder oval, meist nach einer Seite in eine Spitze
ausgezogen, in welcher der Kern eingekeilt liegt. Um den Kern liegt eine geringe Menge Plasma,
das übrige Zelllumen ist von runden gelblichen Kugeln eingenommen, die sich mit Osmium
und Eisen schwärzen und auf Schnitten wiederum aus feinen Körnen zusammen geballt erscheinen.
Die Masse macht einen „fettartigen“ Eindruck. (Taf. IV, Fig. 5.)
*) Ä hnlich e C u ticu larb ild u n g en fin den sich n ic h t selten , z. B. au ch b e i m anch en so n st u n g esch ü tzten R otatorien.
(V ergl. G a s t , B eiträg e zu r K en ntn is v o n A p silu s v o rax Z. f. w . Zool. L X III. 2.)
Wie schon erwähnt würde, findet sich über jeder reifen derartigen Zelle ein Loch in
der Leibeswand und wie gleich hinzugefügt werden mag, konnte an den gleichen Zellen im
„Drüsenwulst“ des Prototroch, die E x k r e t io n dieser körnigen und kugligen Masse am Lebenden
und auf Präparaten nachgewiesen werden.
Es sind also sicher Drüsenzellen und alle ähnlichen „Körnerzellen“, die besonders im
Darmkanal verschiedener Wurmlarven*) gefunden und nach ihrem histologischen Habitus
auch vielfach als Drüsen angesprochen wurden, werden ebenfalls Exkretionsorgane sein.
Das Merkwürdige an diesen Zellen bei der Helgoländer Larve ist ihre Art der Vermehrung
und Wanderung. (Taf. III, Fig. 7 etc.)
Das dem einen Pol der Zelle aufgesetzte, fast stets den Kern bergende Spitzchen findet
sich häufig zu einem immer länger werdenden Fortsatz ausgezogen, in den der Kern hineinrückt,
um wieder dessen äusserste Spitze einzunehmen. Der verbindende Plasmafortsatz wird
dann dünner und dünner, bis das entsteht, was man sehr häufig, namentlich unter dem Epithel
jüngerer Larven sieht, nämlich eine „B a llo n -Z e lle “ . Eine solche besteht aus einer grossen
mit Sekretmasse erfüllten Kugel, die mit der viel kleineren „Gondel“-Zelle durch einen feinen
Plasmafaden verbunden ist. Die Gondelzelle enthält den Kern, etwas Plasma und nach einiger
Zeit ebenfalls Sekretkugeln; solche finden sich nicht selten auch in dem Verbindungsfaden.
Die Gondelzelle wächst, bis sie der Mutterzeile gleich kommt und bildet einen neuen Forts^
z^§ y |u- s- w- Sö entstehen Reihen von 4—6 „Ballonzellen“, die jedoch zusammen nur
einen Kern besitzen — und zwar stets in der letzten, also der Gondelzelle. Solche Gestaltveränderungen,
die zugleich eine Ortsveränderung bedingen, Hessen sich auch an der lebenden
Larve beobachten. Sie gehen jedoch ziemlich langsam vor sich und mehr als die Abtrennung
e in e r solchen Gondelzelle lässt sich nicht beobachten, da die Larven unter dem Objektiv
nicht lange genug frisch bleiben.
In den kernlosen Mutterzellen findet man ausser dem Sekret nur ein wenig Plasma
ani Ansatz des Verbindungsfadens. Das Sekret wird durch ein im Epithel, dem die reife
Zelle anliegt, entstehendes kreisrundes Loch (bei * F igM ^T S k I) entleert.
Der Kern scheint auf seiner Wanderung schliesslich desorganisiert zu werden; während
er in einer einfachen Drüsenzelle oder einer Gondelzelle erster Ordnung ein deutliches Gerüst
und tief tingierbare Nukleolen zeigt, erscheint er am Ende einer solchen Reihe meistens blass
und undifferenziert.
Besonders der einreihige Kranz grösser Drüsenzellen unterhalb des Metatrochs zeigt
fast stets solche „Ballon“-formationen, die meist analwärts gerichtet sind (s. Textfig. 5) und die
Hyposphäre mit Drüsen versorgen, während für die Episphäre der Prototroch-Drüsenwulst
wenigstens zum Teil dieselbe Aufgabe zu haben scheint.
Bei diesen Teilungen handelt es sich nicht um eigentliche Zell-Vermehrung, niemals ist
eine Mitose zu beobachten, aber auch amitotische Kernzerschnürung tritt nur sehr selten auf. Das
Absonderliche liegt darin, dass die Mutterzelle mit Sekret gefüllt, aber kernlos an ihrem Platze
bleibt, während der Kern mit etwas Protoplasma an einer anderen Stelle seine exkretorische
Thätigkeit aufnimmt, um nach einiger Zeit wieder weiter zu wandern. Dass derselbe durch
*) B eisp iele: L o p ad o rh y n chu s K l e i n e n b . 1. c., P o lyn oö („P erlzellen “) H ä c k e r (D ie sp ätere E n tw ick lu ng d e r
Polyn oß-L arve. Zool. Ja h rb . B d. V III).