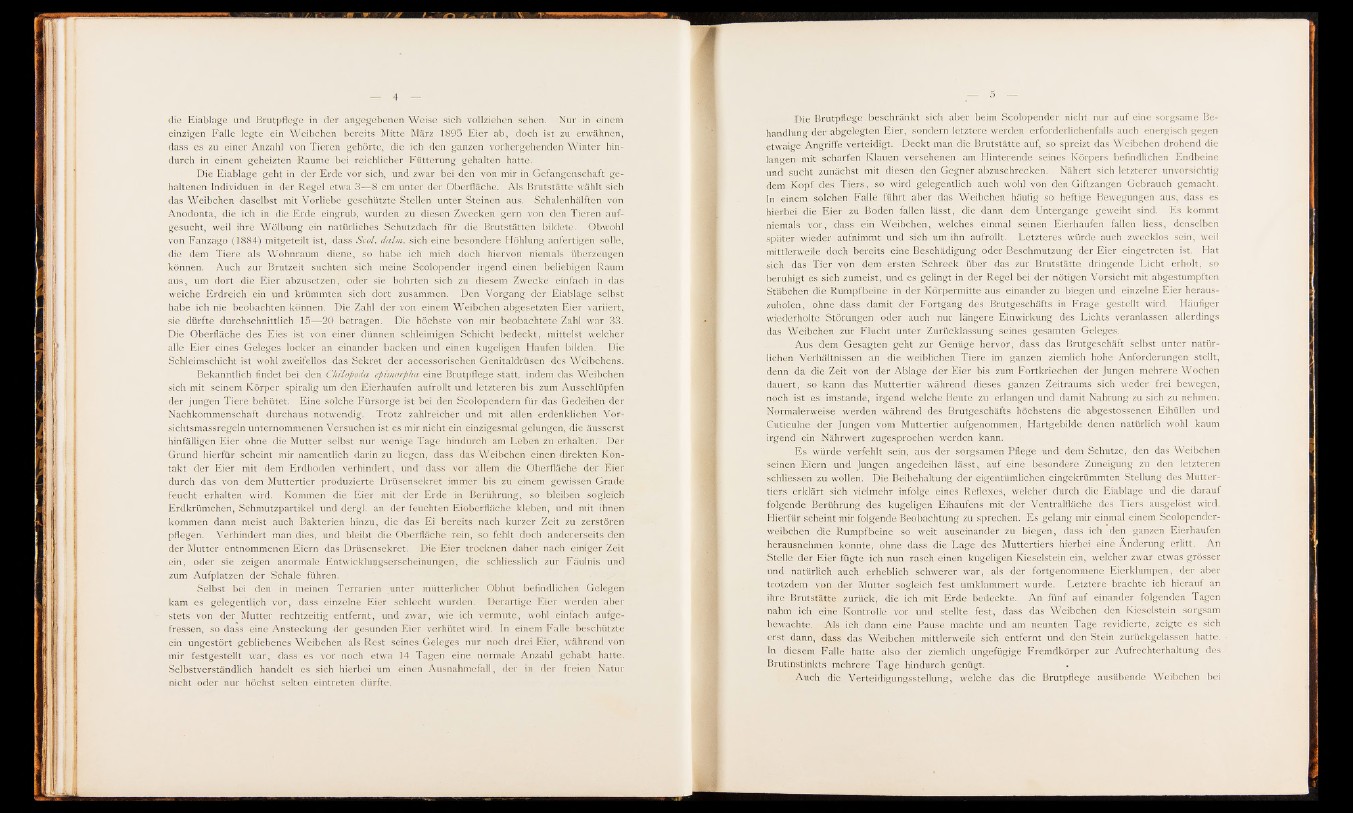
die Eiablage und Brutpflege in der angegebenen Weise sich vollziehen sehen. Nur in einem
einzigen Falle legte ein Weibchen bereits Mitte März 1895 Eier ab, doch ist zu erwähnen,
dass es zu einer Anzahl von Tieren gehörte, die ich den ganzen vorhergehenden Winter hindurch
in einem geheizten Raume bei reichlicher Fütterung gehalten hatte.
Die Eiablage geht in der Erde vor sich, und zwar bei den von mir in Gefangenschaft gehaltenen
Individuen in der Regel etwa 3—8 cm unter der Oberfläche. Als Brutstätte wählt sich
das Weibchen daselbst mit Vorliebe geschützte Stellen unter Steinen aus. Schalenhälften von
Anodonta, die ich in die Erde eingrub, wurden zu diesen Zwecken gern von den Tieren aufgesucht,
weil ihre Wölbung ein natürliches Schutzdach für die Brutstätten bildete. Obwohl
von Fanzago (1884) mitgeteilt ist, dass Scol. dalm. sich eine besondere Höhlung anfertigen solle,
die dem Tiere als Wohnraum diene, so habe ich mich doch hiervon niemals überzeugen
können. Auch zur Brutzeit suchten sich meine Scolopender irgend einen beliebigen Raum
aus, um dort die Eier abzusetzen, oder sie bohrten sich zu diesem Zwecke einfach in das
weiche Erdreich ein und krümmten sich dort zusammen. Den Vorgang der Eiabläge selbst
habe ich nie beobachten können. Die Zahl der von einem Weibchen abgesetzten Eier variiert,
sie dürfte durchschnittlich 15—"20 betragen. Die höchste von mir beobachtete Zahl war 33.
Die Oberfläche des Eies ist von einer dünnen schleimigen Schicht bedeckt, mittelst welcher
alle Eier eines Geleges, locker an einander backen und einen kugeligen Haufen bilden. Die
Schleimschicht ist wohl zweifellos das Sekret der accessorischen Genitaldrüsen des Weibchens.
Bekanntlich findet bei den Chilopoda epimorpha eine Brutpflege statt, indem das Weibchen
sich mit seinem Körper spiralig um den Eierha'ufen aufrollt und letzteren bis zum Ausschlüpfen
der jungen Tiere behütet. Eine solche Fürsorge ist bei den Scolopendern für das Gedeihen der
Nachkommenschaft durchaus notwendig. Trotz zahlreicher und mit allen erdenklichen Vor-
sichtsmassregeln unternommenen Versuchen ist es mir nicht ein einzigesmal gelungen, die äusserst
hinfälligen Eier ohne die Mutter-selbst nur wenige Tage hindurch am Leben zu erhalten.' Der
Grund hierfür scheint mir namentlich darin zu liegen, dass das Weibchen einen direkten Kontakt
der Eier mit dem Erdboden verhindert, und dass vor allem die Oberfläche der Eier
durch das von dem Muttertier produzierte Drüsensekret immer bis zu einem gewissen Grade
feucht erhalten wird. Kommen die Eier mit der Erde in Berührung, so bleiben sogleich
Erdkrümchen, Schmutzpartikel und dergl. an der feuchten Eioberfläche kleben, und mit ihnen
kommen dann meist auch Bakterien hinzu, die das Ei bereits nach kurzer Zeit zu zerstören
pflegen. Verhindert man dies, und bleibt die Oberfläche rein, so fehlt doch andererseits den
der Mutter entnommenen Eiern das Drüsensekret. Die Eier trocknen daher nach einiger Zeit
ein, oder sie zeigen anormale Entwickluogserscheinungen, die schliesslich zur Fäulnis und
zum Aufplatzen der Schale führen.
Selbst bei den in meinen Terrarien unter mütterlicher Obhut befindlichen Gelegen
kam es gelegentlich vor, dass einzelne Eier schlecht wurden. Derartige Eier werden aber
stets von der Mutter rechtzeitig entfernt, und zwar, wie ich vermute, wohl einfach aufgefressen,
so dass eine Ansteckung der gesunden Eier verhütet wird. In einem Falle beschützte
ein ungestört gebliebenes Weibchen als Rest seines Geleges nur noch drei Eier, während von
mir festgestellt war, dass es vor noch etwa 14 Tagen eine normale Anzahl gehabt hatte.
Selbstverständlich handelt es sich hierbei um einen Ausnahmefall, der in der freien Natur
nicht oder nur höchst selten eintreten dürfte.
Die Brutpflege beschränkt sich aber beim Scolopender nicht nur auf eine sorgsame Behandlung
der abgelegten Eier, sondern letztere werden erforderlichenfalls auch energisch gegen
etwaige Angriffe verteidigt. Deckt man die Brutstätte auf, so spreizt das Weibchen drohend die
langen mit scharfen Klauen versehenen am Hinterende seines Körpers befindlichen Endbeine
und sucht zunächst mit diesen den Gegner abzuschrecken. Nähert Sich letzterer unvorsichtig
dem Kopf des Tiers , so wird gelegentlich auch wöhl von den Giftzangen Gebrauch gemacht.
In einem solchen Falle führt aber das Weibchen häufig so heftige Bewegungen aus, dass es
hierbei die Eier zu Boden fallen lässt, die dann dem Untergange geweiht sind. Es kommt
niemals vor, dass ein Weibchen, welches einmal seinen Eierhaufen fallen liess, denselben
später wieder aufnimmt und sich um ihn aufrollt. Letzteres würde auch zwecklos sein, weil
mittlerweile doch bereits eine Beschädigung oder Beschmutzung der Eier eingetreten ist. Hat
sich das Tier von dem ersten Schreck über das zur Brutstätte dringende Licht erholt, so
beruhigt es sich zumeist, und es gelingt in der Regel bei der nötigen Vorsicht mit abgestumpften
Stäbchen die Rumpfbeine in der Körpermitte aus einander zu biegen und einzelne Eier herauszuholen,
ohne dass damit der Fortgang des Brutgeschäfts in Frage gestellt wird. Häufiger
wiederholte Störungen oder auch nur längere Einwirkung des Lichts veranlassen allerdings
das Weibchen zur Flucht unter Zurücklassung seines gesamten Geleges.
Aus dem Gesagten geht zur Genüge hervor, dass das Brutgeschäft selbst unter natürlichen
Verhältnissen an die weiblichen Tiere im ganzen ziemlich hohe Anforderungen stellt,
denn da die Zeit von der Ablage der Eier bis zum Fortkriechen der Jungen mehrere Wochen
dauert, so kann das Muttertier während dieses ganzen Zeitraums sich weder frei bewegen,
noch ist es imstande, irgend welche Beute zu erlangen und damit Nahrung zu sich zu nehmen.
Normalerweise werden während des Brutgeschäfts höchstens die abgestossenen Eihüllen und
Cuticulae der Jungen vom Muttertier aufgenommen, Hartgebilde denen natürlich wohl kaum
irgend ein Nährwert zugesprochen werden kann.
Es würde verfehlt sein, aus der sorgsamen Pflege und dem Schutze, den das Weibchen
seinen Eiern und Jungen angedeihen lässt, auf eine besondere Zuneigung zu den letzteren
schliessen zu wollen. Die Beibehaltung der eigentümlichen eingekrümmten Stellung des Muttertiers
erklärt sich vielmehr infolge eines Reflexes, welcher durch die Eiablage und die darauf
folgende Berührung des kugeligen Eihaufens mit der Ventralfläche des Tiers ausgelöst wird.
Hierfür scheint mir folgende Beobachtung zu sprechen. Es gelang mir einmal einem Scolopender-
weibchen die Rumpfbeine so weit auseinander zu biegen, dass ich den ganzen Eierhaufen
herausnehmen konnte, ohne dass die Lage des Muttertiers hierbei eine Änderung erlitt. An
Stelle der Eier fügte ich nun rasch einen kugeligen Kieselstein ein, welcher zwar etwas grösser
Und natürlich auch erheblich schwerer war, als der fortgenommene Eierklumpen, der aber
trotzdem von der Mutter sogleich fest umklammert wurde. Letztere brachte ich hierauf an
ihre Brutstätte zurück, die ich mit Erde bedeckte. An fünf auf einander folgenden Tagen
nahm ich eine Kontrolle vor und stellte fest, dass das Weibchen den Kieselstein sorgsam
bewachte. Als ich dann eine Pause machte und am neunten Tage revidierte, zeigte es sich
erst dann, dass das Weibchen mittlerweile sich entfernt und den Stein zurückgelassen hatte.
In diesem Falle hatte also der ziemlich ungefügige Fremdkörper zur Aufrechterhaltung des
Brutinstinkts mehrere Tage hindurch genügt.
Auch die Verteidigungsstellung, welche das die Brutpflege ausübende Weibchen bei