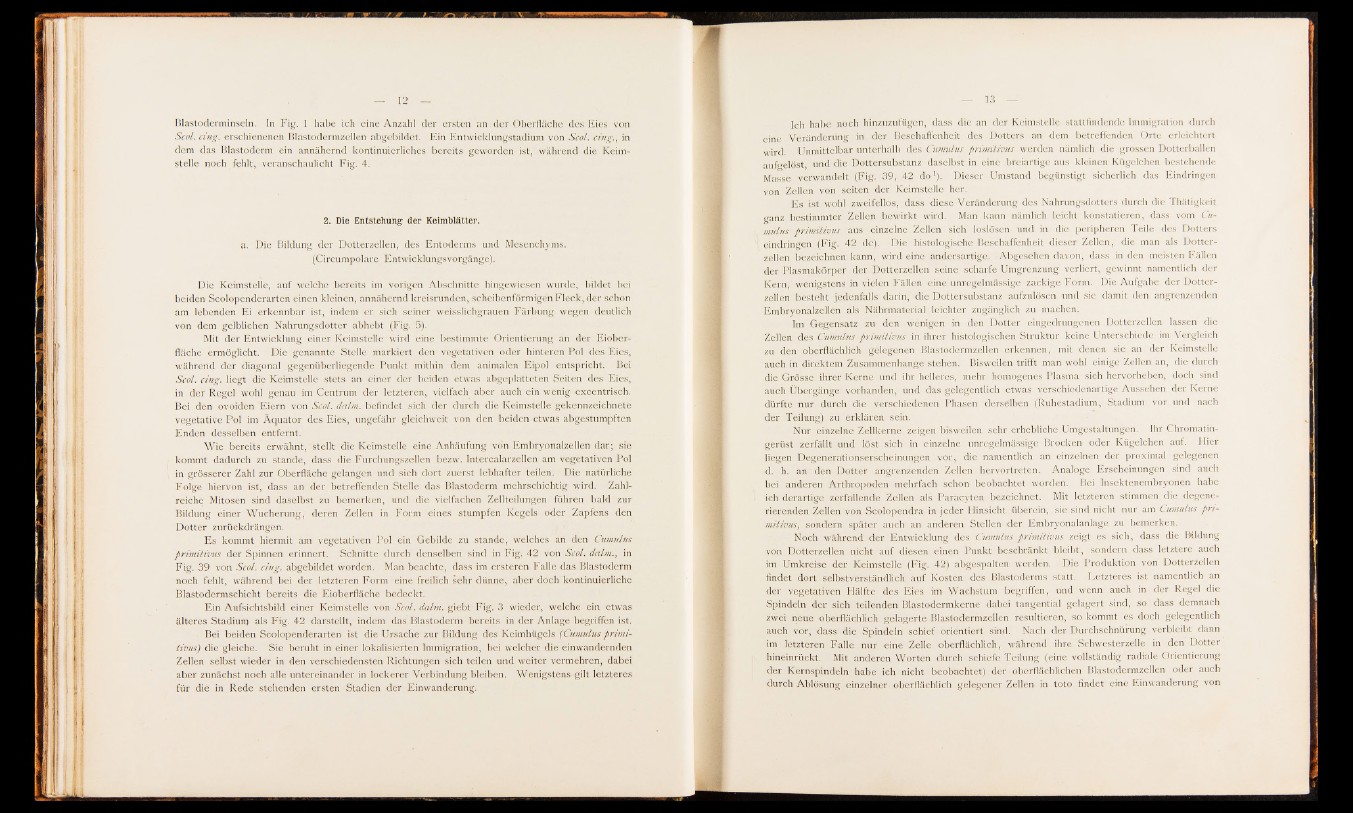
Blastoderminseln. In Fig. 1 habe ich eine Anzahl der ersten an der Oberfläche des Eies von
Scol. cing. erschienenen Blästodermzellen abgebildet. Ein Entwicklungstadium von Scol. cing., in
dem das Blastoderm ein annähernd kontinuierliches bereits geworden ist, während die Keim-
Stelle noch fohlt, veranschaulicht Fig. 4.
2. Die Entstehung der Keimblätter.
a. Die Bildung der Dotterzellen, des Entoderms und Mesenchyms.
(Circumpolare Entwicklungsvorgänge).
Die Keimstelle, auf welche bereits im vorigen Abschnitte hingewiesen wurde, bildet bei
beiden Scolopenderarten einen kleinen, annähernd kreisrunden, scheibenförmigen Fleck, der schon
am lebenden Ei erkennbar ist, indem er sich seiner weisslichgrauen Färbung wegen deutlich
von dem gelblichen Nahrungsdotter abhebt (Fig. 5).
Mit der Entwicklung einer Keimstelle wird eine bestimmte Orientierung an der Eioberfläche
ermöglicht. Die genannte Stelle markiert den vegetativen oder hinteren Pol des Eies,
während der diagonal gegenüberliegende Punkt mithin dem anim.alen Eipol entspricht. Bei
Scol. cing. liegt die Keimstelle stets an einer der beiden etwas abgeplatteten Seiten des Eies,
in der Regel wohl genau im Centrum der letzteren, vielfach aber auch ein wenig excentrisch.
Bei den o.voiden Eiern von Scol. dalm. befindet sich der durch die Keimstelle gekennzeichnete
vegetative Pol im Äquator des Eies, ungefähr gleichweit von den beiden etwas abgestumpften
Enden desselben entfernt.
Wie bereits erwähnt, stellt die Keimstelle eine Anhäufung von Embryonalzellen dar; sie
kommt dadurch zu Stande, dass die Furchungszellen bezw. Intercalarzellen am vegetativen Pol
in grösserer Zahl zur Oberfläche gelangen und sich dort zuerst lebhafter teilen. Die natürliche
Folge hiervon ist, dass an der betreffenden Stelle das Blastoderm mehrschichtig wird. Zahlreiche
Mitosen sind daselbst zu bemerken, und die vielfachen Zellteilungen führen bald zur
Bildung einer Wucherung, deren Zellen in Form eines stumpfen Kegels oder Zapfens den
Dotter zurückdrängen.
Es kommt hiermit am vegetativen Pol ein Gebilde zu Stande, welches an den Cumulus
primitivus der Spinnen erinnert. Schnitte durch denselben sind in Fig. 42 von Scol. dalm'., in
Fig. 39 von Scol. cing. abgebildet worden. Man beachte, dass im ersteren Falle das Blastoderm
noch fehlt, während bei der letzteren Form eine freilich sehr dünne, aber doch kontinuierliche
Blastodermschicht bereits die Eioberfläche bedeckt.
Ein Aufsichtsbild einer Keimstelle von Scol. dalm. giebt Fig. 3 wieder, welche ein etwas
älteres Stadiurn als Fig. 42 darstellt, indem das Blastoderm bereits in der Anlage begriffen ist.
Bei beiden Scolopenderarten ist die Ursache zur Bildung des Keimhügels (Cumulus primi-
tivus) die gleiche. Sie beruht in einer lokalisierten Immigration, bei welcher die einwandernden
Zellen selbst wieder in den verschiedensten Richtungen sich teilen und weiter vermehren, dabei
aber zunächst noch alle untereinander in lockerer Verbindung bleiben. Wenigstens gilt letzteres
für die in Rede stehenden ersten Stadien der Einwanderung.
Ich habe noch hinzuzufügen, dass die an der Keimstelle stattfindende Immigration durch
eine Veränderung in der Beschaffenheit des Dotters an dem betreffenden Orte erleichtert
wird. Unmittelbar unterhalb des Cumulus primitivus werden nämlich die grossen Dotterballen
aufgelöst, und die Dottersubstanz daselbst in eine breiartige aus kleinen Kügelchen bestehende
Masse verwandelt (Fig. 39, 42 d o x). Dieser Umstand begünstigt sicherlich das Eindringen
von Zellen von seiten der Keimstelle her.
Es ist wohl zweifellos, dass diese Veränderung des Nahrungsdotters durch die Thätigkeit
ganz bestimmter Zellen bewirkt wird. Man kann nämlich leicht konstatieren, dass vom Cumulus
primitivus aus einzelne Zellen sich loslösen und in die peripheren Teile des Dotters
eindringen (Fig. 42 de). Die histologische Beschaffenheit dieser Zellen, die man als Dotterzellen
bezeichnen kann, wirdeine andersartige. Abgesehen davon, dass in den meisten Fällen
der Plasmakörper der Dotterzellen seine scharfe Umgrenzung verliert, gewinnt namentlich der
Kern wenigstens in vielen Fällen eine unregelmässige zackige Form. Die Aufgabe der Dotterzellen
besteht jedenfalls darin, die Dottersubstanz aufzulösen und sie damit den angrenzenden
Embryonalzellen als Nährmaterial leichter zugänglich zu machen.
Im Gegensatz zu den wenigen in den Dotter eingedrungenen Dotterzellen lassen die
Zellen des Cumulus primitivus in ihrer histologischen Struktur keine Unterschiede im Vergleich
zu den oberflächlich gelegenen Blästodermzellen erkennen, mit denen sie an der Keimstelle
auch in direktem Zusammenhänge stehen. Bisweilen trifft man wohl einige Zellen an, die durch
die Grösse ihrer Kerne und ihr helleres, mehr homogenes Plasma sich hervorheben, doch sind
auch Übergänge vorhanden, und das gelegentlich etwas verschiedenartige Aussehen der Kerne
dürfte nur durch die verschiedenen Phasen derselben (Ruhestadium, Stadium vor und nach
der Teilung) zu erklären sein.
Nur einzelne Zellkerne zeigen bisweilen sehr erhebliche Umgestaltungen. Ihr Chromatin-
gerüst zerfällt und löst sich in einzelne unregelmässige Brocken oder Kügelchen auf. Hier
liegen Degenerationserscheinungen vor, die namentlich an einzelnen der proximal gelegenen
d. h. an den Dotter angrenzenden Zellen hervortreten. Analoge Erscheinungen sind auch
bei anderen Arthropoden mehrfach schon beobachtet worden. Bei Insektenembryonen habe
ich derartige zerfallende Zellen als Paracyten bezeichnet. Mit letzteren stimmen die degenerierenden
Zellen von Scolopendra in jeder Hinsicht überein, sie sind nicht nur am Cumulus primitivus,
sondern später auch an anderen Stellen der Embryonalanlage zu bemerken-
Noch während der Entwicklung des Cumulus primitivus zeigt es sich, dass die Bildung
von Dotterzellen nicht auf diesen einen Punkt beschränkt bleibt, sondern dass letztere auch
im Umkreise der Keimstelle (Fig. 42) abgespalten werden. Die Produktion von Dotterzellen
findet dort selbstverständlich auf Kosten des Blastoderms statt. Letzteres ist namentlich an
der vegetativen Hälfte des Eies im Wachstum begriffen, und wenn auch in der Regel die
Spindeln der sich teilenden Blastodermkerne dabei tangential gelagert sind, so dass demnach
zwei neue oberflächlich gelagerte Blästodermzellen resultieren, so kommt es doch gelegentlich
auch vor, dass die Spindeln schief orientiert sind. Nach der Durchschnürung verbleibt dann
im letzteren Falle nur eine Zelle oberflächlich, während ihre Schwesterzelle in den Dotter
hineinrückt. Mit anderen Worten durch schiefe Teilung (eine vollständig radiale Orientierung
der Kernspindeln habe ich nicht beobachtet) der oberflächlichen Blästodermzellen oder auch
durch Ablösung einzelner oberflächlich gelegener Zellen in toto findet eine Einwanderung von