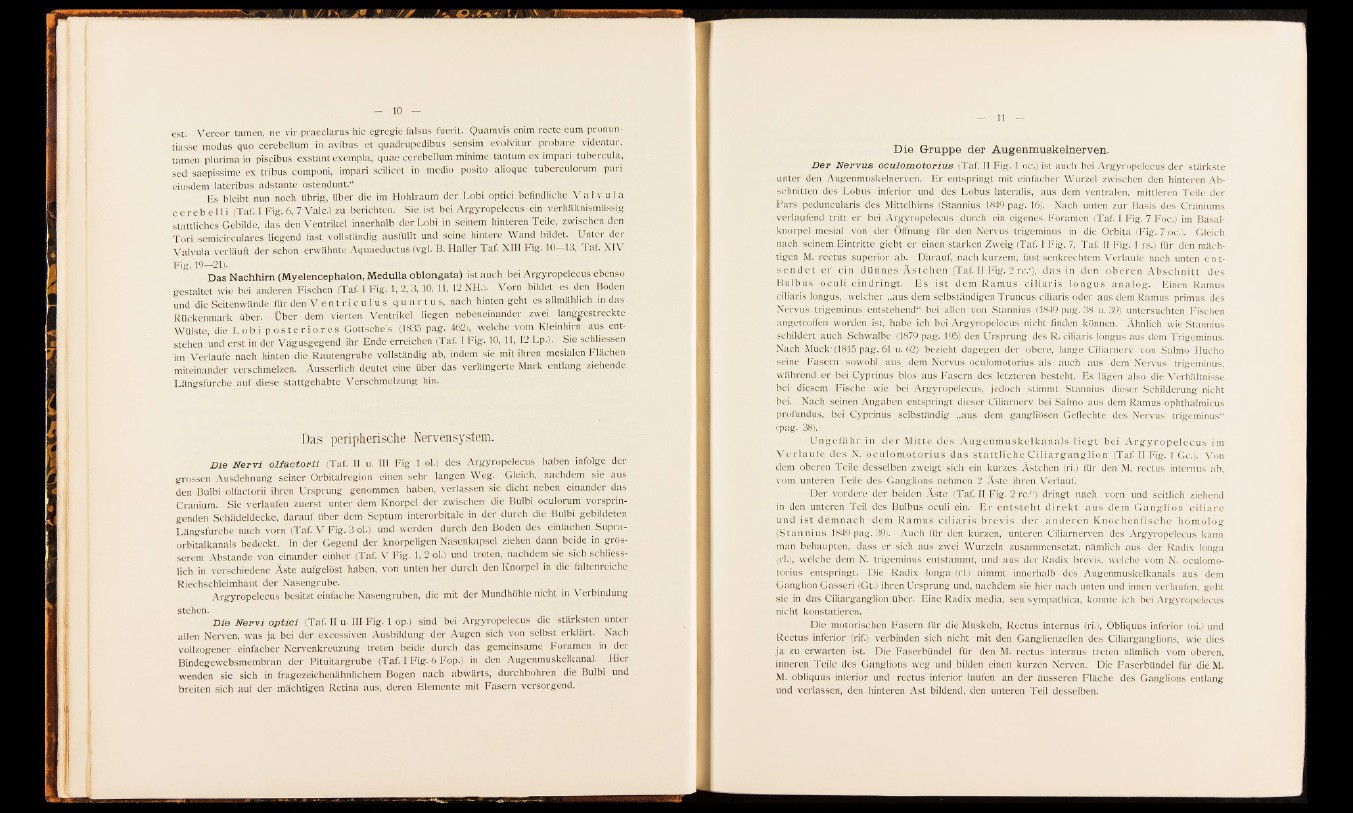
est. Vereor tarnen, ne vir praeclarus hic egregie falsus fuerit. Quamvis enim recte eum pronun-
tiasse modus quo cerebellum in avibus . et quadrupedibus sensim evolvitur probare videatur,
tarnen plurimain piscibus exstant exempla, q u a e cerebellum minime tantum ex impari tubercula,
sed saepissime ex tribus componi, impari scilicet in medio posito alioque tuberculorum pari
eiusdem lateribus adstante ostendunt.“
Es bleibt nun noch übrig, Uber die im Hohlraum der Lobi optici befindliche V a l v u l a
c e r e b e l l i (Taf. I Fig. 6, 7 Vald.) zu berichten. Sie ist bei Argyropelecus-ein verhältnismässig
stattliches Gebilde, das den Ventrikel innerhalb der Lobi in seinem hinteren Teile, zwischen den
Tori semicirculares liegend fast vollständig ausfüllt und seine hintere Wand bildet. Unter der
Valvula verläuft der schon erwähnte Aquaeductus (vgl. B. Haller Taf. XIII Fig. 10 - .13. Taf. XIV
19—21).
Das Nachhirn (Myelencephalon, Medulla oblongata) ist auch bei Argyropelecus ebenso
gestaltet wie bei anderen Fischen (Taf. I Fig. 1, 2, 3, 10. 11, 12 NH.H Vorn bildet es den Boden
und die Seitenwände für den V e n t r i c u l u s q u a r t u s , nach hinten geht es allmählich in-das
Rückenmark über. Über dem vierten Ventrikel liegen nebeneinander zwei langgestreckte
Wülste,.die L o b i p o s t e r i o r e s Gottsched (1835 pag. 462), welche vom Kleinhirn aus entstehen
und erst in der Vagusgegend ihr Ende erreichen (Taf. I Fig. 10, 11, 42 L p .g Sie schliessen
im Verlaufe nach hinten die Rautengrube vollständig ab, indem sie mit ihren mesialen Flächen
miteinander verschmelzen. Äusserlich deutet eine über das verlängerte Mark entlang ziehende
Längsfurche auf diese stattgehabte Verschmelzung hin.
Das peripherische Nervensystem.
Die N e rv i o lfa c to rii (Taflft u. III Fig 1 ol.) des Argyropelecus haben infolge der
grossen Ausdehnung seiner Orbitalregion einen sehr langen Weg. Gleich, nachdem sie aus
den Bulbi olfactorii ihren Ursprung genommen haben, verlassen sie dicht neben einander das
Cranium. Sie verlaufen zuerst unter dem Knorpel der zwischen die Bulbi oculorum vorspringenden
Schädeldecke, darauf über dem Septum interorbitale in der durch die Bulbi gebildeten
Längsfurche nach vorn (Taf. V Fig. 3 ol.) und werden durch den Boden des einfachen Supraorbitalkanals
bedeckt. In der Gegend der knorpeligen Nasenkapsel ziehen dann beide in grösserem
Abstande von einander einher (Taf. V Fig. 1, 2 61.) und treten, nachdem sie sich schliess--
lieh in verschiedene Äste aufgelöst haben, von unten her durch den Knorpel in die faltenreiche
Riechschleimhaut der Nasengrube.
Argyropelecus besitzt einfache Nasengruben, die mit der Mundhöhle nicht in Verbindung
stehen.
Die N e rv i o p tic i (Taf. il u. III Fig. 1 op.) sind bei Argyropelecus die stärksten unter
allen Nerven, was ja bei der excessiven Ausbildung der Augen sich von selbst erklärt. Nach
vollzogener einfacher Nervenkreuzung treten beide durch das gemeinsame Foramen in der
Bindegewebsmembran der Pituitargrube (Taf. I Fig. 6 Fop.) in den Augenmuskelkanal. Hier
wenden sie sich in fragezeichenähnlichem Bogen nach abwärts, durchbohren die Bulbi und
breiten sich auf der mächtigen Retina aus, deren Elemente mit Fasern versorgend. -
Die Gruppe der Augenmuskelnerven.
Der N e rvu s oculomotorius (Taf. II Fig. 1 öS) ist auch bei Argyropelecus der stärkste
unter den Äugenmuskelnerven. Er entspringt mit einfacher Wurzel zwischen den hinteren Abschnitten
des Lobus inferior und des Lobus lateralis, aus dem ventralen, mittleren Teile der
Pars peduncularis des Mittelhirns (Stannius 1849 pag. 16). Nach unten zur Basis des Craniums
verlaufend tritt er bei Argyropelecus durch ein eigenes-Foramen (Taf. I Fig. 7 Foc.) im Basal-
knöfpel mesial von der Öffnung für den Nervus trigeminus in die Orbita (Fig. 7 oc.). Gleich
nach seinem Eintritte giebt er einen starken Zweig (Taf. I Fig. 7, Taf. II Fig. 1 rs.) für den mächtigen
M. rectus superior ab. Darauf, nach kurzem, fast senkrechtem Verlaufe nach unten e n ts
e n d e t er. ein d ünnes Ä s tc h e n (Taf. II Fig. 2 re.'), d a s in den o b e ren A b sch n itt des
B ill# » :;6culi e indringt. E s is t dem Ramus c ilia ris lo n g u s analog. Einen Ramus
ciliaris longus, welcher „aus dem selbständigen Truncus ciliaris oder aus dem Ramus primus des
Nervus .trigeminus entstehend“ bei aäten von Stannius (1849 pag. 38 u. 39) untersuchten Fischen
angetroffen worden .ist, habe ich bei Argyropelecus dicht finden können. Ähnlich wie Stannius
schildert auch Schwalbe (18/9 pag. 1-95} den Ursprung des R. ciliaris longus aus dem Trigeminus.
Nach Muck'(1815 pag. 61 u. 62) bezieht dagegen der obère, lange Ciliamerv von Salmo Hucho
Seine Fasern sowohl .aus. dem Nervus oculomotorius als auch aus dem Nervus trigeminus,
während er bei Gyprinus blos aus Fasern des letzteren besteht. Es lägen also die Verhältnisse
bei diesem, Fische .wie bei Argyropelecus, jedoch stimmt Stannius dieser Schilderung nicht
bei. Nach seinen Angaben entspringt dieser Ciliarnerv bei Salmo aus dem Ramus ophthalmicus
profunduS,. bei Cyprinus selbständig „aus dem gangliösen Geflechte des Nervus trigeminus“
(pagisiSkÄi
.U n g e fä h r in d e r M itte des A ü g ènm iïsk e lk an a ls lie g t bei A rg y ro p e le c u s im
V e rla u fe des N. ocu lom o to riu s/ d a s s ta ttlic h e C ilia rg a n g lio n (Taf. II Fig. 1 Gc.). Von
dem oberen Teile desselben zweigt sich- ein kurzes Ästchen (ri.) für den M. réctus internus ab,
vom unteren Teile, des Ganglions nehmen 2 Äste ihren Verlauf.
Der vordere der beiden Aste (Taf. II Fig. 2 rc.“) dringt nach vorn und seitlich ziehend
in den unteren Teil des Bulbus .oculi ein. E r e n ts te h t d ire k t au s dem Gan g lio n c ilia re
und ist.d em n a c h dem Ramus c ilia ris b re v is d e r an d eren Kn o ch en fisch e homolog
(Stannius 1849 pag. 39;. Auch für den kurzen, unteren1 Ciliarnerven des Argyropelecus kann
man behaupten, dass er sielt aus zwei Wurzeln zusammensetzt, nämlich aus der Radix longa
(rl.), welche dem N. trigeminus entstammt, und aus der Radix brevis, welche vom ,N. oculomotorius
entspringt. Die Radix longa (rl.) nimmt innerhalb des Augenmuskelkanals aus dem
Ganglion Gasseri (Gt.) ihren Ursprung und, nachdem sie hier nach unten und innen verlaufen, geht
sie in das Ciliarganglion über. Eine Radix media, seu sympathica, konnte ich bei Argyropelecus
nicht konstatieren.
Die motorischen Fasern für die Muskeln, Rectus internus (ri.), Obliquus inferior (oi.) und
Rectus inferior (rif.) verbinden sich nicht mit den Ganglienzellen des Ciliarganglions, wie dies
ja zu erwarten ist. Die Faserbündel für den M. rectus intèmus treten nämlich vom oberen,
inneren Teile des Ganglions weg und bilden einen kurzen Nerven. Die Faserbündel für die M.
M. obliquus inferior und rectus inferior laufen an der äusseren Fläche des Ganglions entlang
und verlassen, den hinteren Ast bildend, den unteren Teil desselben.