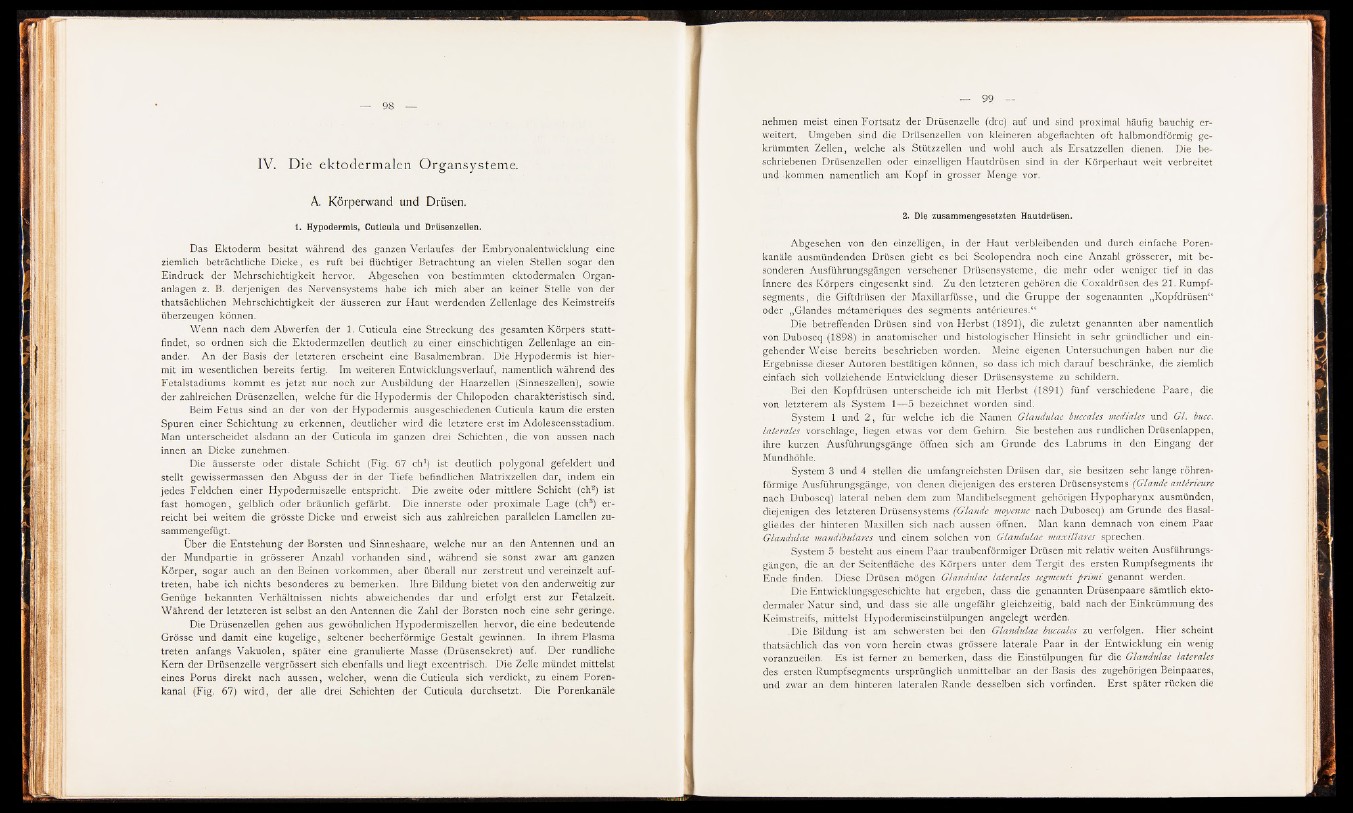
IV. D ie ek to d e rm a len O r g a n sy s tem e .
A. Körperwand und Drüsen.
1. Hypodermis, Cuticula und Drüsenzellen.
Das Ektoderm besitzt während des ganzen Verlaufes der Embryonalentwicklung eine
ziemlich beträchtliche Dicke, es ruft bei flüchtiger Betrachtung an vielen Stellen sogar den
Eindruck der Mehrschichtigkeit hervor. Abgesehen von bestimmten ektodermalen Organanlagen
z. B. derjenigen des Nervensystems habe ich mich aber an keiner Stelle von der
thatsächlichen Mehrschichtigkeit der äusseren zur Haut werdenden Zellenlage des Keim Streifs
überzeugen können.
Wenn nach dem Abwerfen der 1 . Cuticula eine Streckung des gesamten Körpers stattfindet,
so ordnen sich die Ektodermzellen deutlich zu einer einschichtigen Zellenlage an einander.
An der Basis der letzteren erscheint eine Basalmembran. Die Hypodermis ist hiermit
im wesentlichen bereits fertig. Im weiteren Entwicklungsverlauf, namentlich während des
Fetalstadiums kommt es jetzt nur noch zur Ausbildung der Haarzellen (Sinneszellen), sowie
der zahlreichen Drüsenzellen, welche für die Hypodermis der Chilopoden charakteristisch sind.
Beim Fetus sind an der von der Hypodermis ausgeschiedenen Cuticula kaum die ersten
Spuren einer Schichtung, zu erkennen, deutlicher wird die letztere erst im Adolescensstadium.
Man unterscheidet alsdann an der Cuticula im ganzen drei Schichten, die von aussen nach
innen an Dicke zunehmen.
Die äusserste oder distale Schicht (Fig. 67 ch1) ist deutlich polygonal gefeldert und
stellt gewissermassen den Abguss der in der Tiefe befindlichen Matrixzellen dar, indem ein
jedes Feldchen einer Hypodermiszelle entspricht. Die zweite oder mittlere Schicht (ch2) ist
fast homogen, gelblich oder bräunlich gefärbt. Die innerste oder proximale Lage (ch3) erreicht
bei weitem die grösste Dicke und erweist sich aus zahlreichen parallelen Lamellen zusammengefügt.
Über die Entstehung der Borsten und Sinneshaare, welche nur an den Antennen und an
der Mundpartie in grösserer Anzahl vorhanden sind, während sie sonst zwar am ganzen
Körper, sogar auch an den Beinen Vorkommen, aber überall nur zerstreut und vereinzelt auf-
treten, habe ich nichts besonderes zu bemerken. Ihre Bildung bietet von den anderweitig zur
Genüge bekannten Verhältnissen nichts abweichendes dar und erfolgt erst zur Fetalzeit.
Während der letzteren ist selbst an den Antennen die Zahl der Borsten noch eine sehr geringe.
Die Drüsenzellen gehen aus gewöhnlichen Hypodermiszellen hervor, die eine bedeutende
Grösse und damit eine kugelige, seltener becherförmige Gestalt gewinnen. In ihrem Plasma
treten anfangs Vakuolen, später eine granulierte Masse (Drüsensekret) auf. Der rundliche
Kern der Drüsenzelle vergrössert sich ebenfalls und liegt excentrisch. Die Zelle mündet mittelst
eines Porus direkt nach aussen, welcher, wenn die Cuticula sich verdickt, zu einem Porenkanal
(Fig. 67) wird, der alle drei Schichten der Cuticula durchsetzt. Die Porenkanäle
nehmen meist einen Fortsatz der Drüsenzelle (drc) auf und sind proximal häufig bauchig erweitert.
Umgeben sind die Drüsenzellen von kleineren abgeflachten oft halbmondförmig gekrümmten
Zellen, welche als Stützzellen und wohl auch als Ersatzzellen dienen. Die beschriebenen
Drüsenzellen oder einzelligen Hautdrüsen sind in der Körperhaut weit verbreitet
und kommen namentlich am Kopf in grösser Menge vor.
2. Die zusammengesetzten Hautdrüsen.
Abgesehen von den einzelligen, in der Haut verbleibenden und durch einfache Porenkanäle
ausmündenden Drüsen giebt es bei Scolopendra noch eine Anzahl grösserer, mit besonderen
Ausführungsgängen versehener Drüsensystem^'i die mehr oder weniger tief in das
Innere des Kôrpèrs eingesenkt sind. Zu den letzteren gehören die Coxaldrüsen des 21. Rumpfsegments,
die Giftdrüsen der Maxillarfüsse, und die Gruppe der sogenannten „Kopfdrüsen“
oder „Glandes métameriques des segments antérieures.“
Die betreffenden Drüsen sind von Herbst (1891), die zuletzt genannten aber namentlich
von Duboscq (1898) in anatomischer und histologischer Hinsicht in sehr gründlicher und eingehender
Weise bereits beschrieben worden. Meine eigenen Untersuchungen haben nur die
Ergebnisse dieser Autoren bestätigen können, so dass ich mich darauf beschränke, die ziemlich
einfach sich vollziehende Entwicklung dieser Drüsensysteme zu schildern.
Bei den Kopfdrüsen unterscheide ich mit Herbst (1891) fünf verschiedene Paare, die
von letzterem als System 1—5 bezeichnet worden sind.
System 1 und 2, für welche ich die Namen Glandulae buccales mediales und Gl. bucc.
laterales vorschlage, liegen etwas vor dem Gehirn. Sie bestehen aus rundlichen Drüsenlappen,
ihre kurzen Ausführungsgänge öffnen sich am Grunde des Labrums in den Eingang der
Mundhöhle.
System 3 und 4 stellen die umfangreichsten Drüsen dar, sie besitzen sehr lange röhrenförmige
Ausführungsgänge, von denen diejenigen des ersterèn Drüsensystems (Glande antérieure
nach Duboscq) lateral neben dem zum Mandibelsegment gehörigen Hypopharynx ausmünden,
diejenigen de& letzteren Drüsensystems (Glande moyenne nach Duboscq) am Grunde des Basalgliedes
der hinteren Maxillen sich nach aussen öffnen. Man kann demnach von einem Paar
Glandulae mandibulares und einem solchen von Glandulae maxillares sprechen.
System 5 besteht aus einem Paar traubenförmiger Drüsen mit relativ weiten Ausführungsgängen,
die an der Seitenfläche des Körpers unter dem Tergit des ersten Rumpfsegments ihr
Ende finden. Diese Drüsen mögen Glandidae laterales segmenti primi genannt werden.
Die Entwicklungsgeschichte hat ergeben, dass die genannten Drüsenpaare sämtlich ekto-
dermaler Natur sind, und dass sie alle ungefähr gleichzeitig, bald nach der Einkrümmung des
Keimstreifs, mittelst Hypodermiseinstülpungen angelegt werden.
.Die Bildung ist am schwersten bei den Glandidae buccales zu verfolgen. Hier scheint
thatsächlich das von vorn herein etwas grössere laterale Paar in der Entwicklung ein wenig
voranzueilen. Es ist ferner zu bemerken, dass die Einstülpungen für die Glandulae laterales
des ersten Rumpfsegments ursprünglich unmittelbar an der Basis des zugehörigen Beinpaares,
und zwar an dem hinteren lateralen Rande desselben sich vorfinden. Erst später rücken die