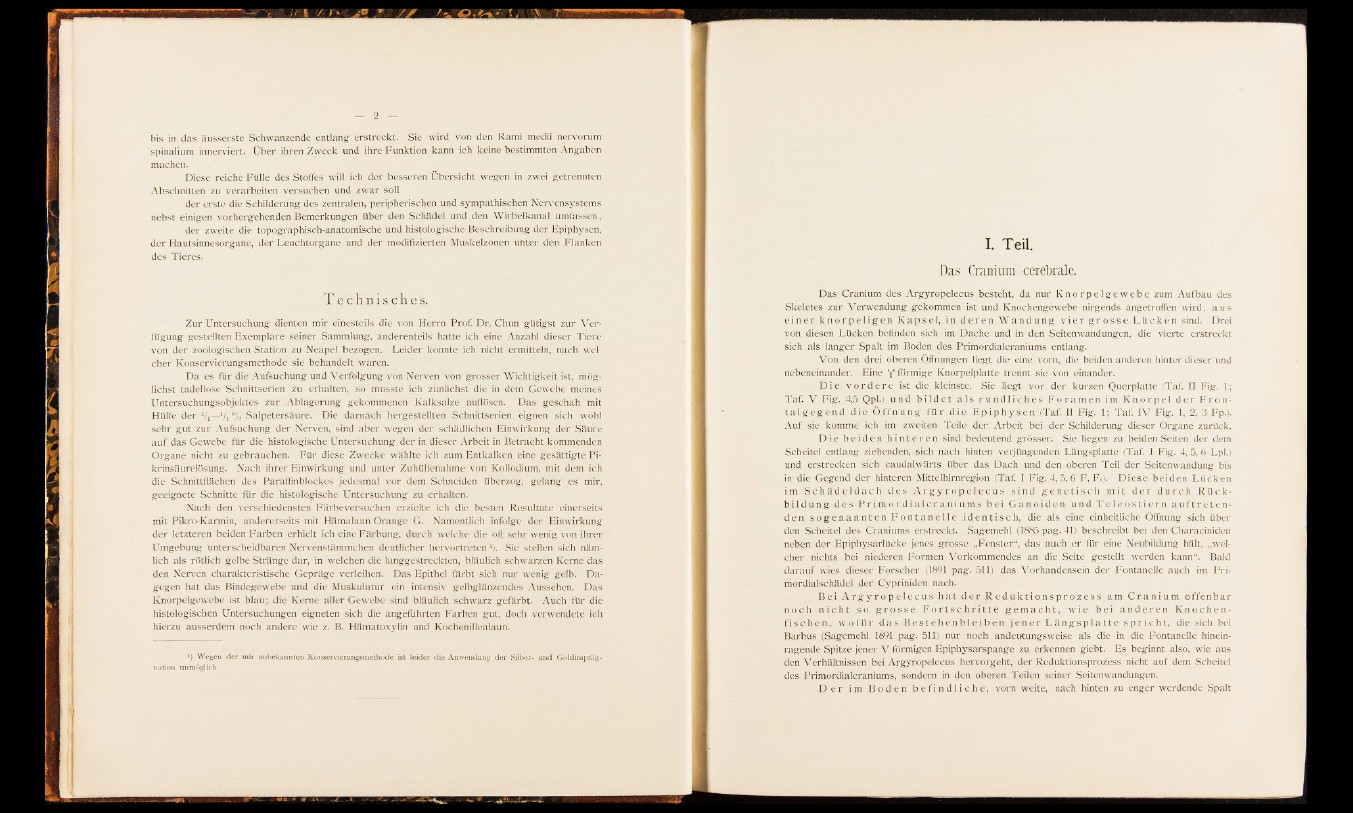
bis in das äusserste Schwanzende entlang erstreckt. Sie wird von den Rami medii nervorum
spinalium innerviert. Über ihren Zweck und ihre Funktion kann ich keine bestimmten Angaben
machen.
Diese reiche Fülle des Stoffes will ich der besseren Übersicht wegen in zwei getrennten
Abschnitten zu verarbeiten versuchen und zwar soll
der erste die Schilderung des zentralen, peripherischen und sympathischen Nervensystems
nebst einigen vorhergehenden Bemerkungen über den Schädel und den Wirbelkanal umfassen,
der zweite die topographisch-anatomische und histologische Beschreibung der Epiphysen,
der Hautsinnesorgane, der Leuchtorgane und der modifizierten Muskelzonen unter den Flanken
des Tieres.
T e c h n i s c h e s,
Zur Untersuchung dienten mir einesteils die von Herrn Prof. Dr. Chun gütigst zur Verfügung
gestellten Exemplare seiner Sammlung, anderenteils hatte ich eine Anzahl dieser Tiere
von der zoologischen Station zu Neapel bezogen. Leider konnte ich nicht ermitteln, nach welcher
Konservierungsmethode sie behandelt waren.
Da es für die Aufsuchung und Verfolgung von Nerven von grösser Wichtigkeit ist, möglichst
tadellose Schnittserien zu erhalten, so musste ich zunächst die in dem Gewebe meines
Untersuchungsobjektes zur Ablagerung gekommenen Kalksalze auflösen. Das geschah mit
Hülfe der Vs—Vi°/o Salpetersäure. Die darnach hergestellten Schnittserien eignen sich wohl
sehr gut zur Aufsuchung der Nerven, sind aber wegen der schädlichen Einwirkung der Säure
auf das Gewebe für die histologische Untersuchung der in dieser Arbeit in Betracht kommenden
Organe nicht zu gebrauchen. Für diese Zwecke wählte ich zum Entkalken eine gesättigte Pikrinsäurelösung.
Nach ihrer Einwirkung und unter Zuhülfenahme von Kollodium, mit dem ich
die Schnittflächen des Paraffinblockes jedesmal vor dem Schneiden überzog, gelang es mir,
geeignete Schnitte für die histologische Untersuchung zu erhalten.
Nach den verschiedensten Färbeversuchen erzielte ich die besten Resultate einerseits
mit Pikro-Karmin, andererseits mit Hämalaun Orange G. Namentlich infolge der Einwirkung
der letzteren beiden Farben erhielt ich eine Färbung, durch welche die oft sehr wenig von ihrer
Umgebung unterscheidbaren Nervenstämmchen deutlicher hervortreten *). Sie stellen sich nämlich
als rötlich gelbe Stränge dar, in welchen die langgestreckten, bläulich schwarzen Kerne das
den Nerven charakteristische Gepräge verleihen. Das Epithel färbt sich nur wenig gelb. Dagegen
hat das Bindegewebe und die Muskulatur ein intensiv gelbglänzendes Aussehen. Das
Knorpelgewebe ist blau; die Kerne aller Gewebe sind bläulich schwarz gefärbt. Auch für die
histologischen Untersuchungen eigneten sich die angeführten Farben gut, doch verwendete ich
hierzu ausserdem noch andere wie z. B. Hämatoxylin und Kochenillealaun.
V Wegen der mir unbekannten Konservierungsmethode ist leider die Anwendung der Silber- und Goldimprägnation
unmöglich. ' . .
Das Cranium cerebrale.
Das Cranium des Argyropelecus besteht, da nur K n o r p e lg ew e b e zum Aufbau des
Skeletes zur Verwendung gekommen ist und Knochengewebe nirgends angetroffen wird, a u s
e in e r k n o r p e l i g e n K a p s e l, in d e r e n W a n d u n g v i e r g r o s s e L ü c k e n sind. Drei
von diesen Lücken befinden sich im Dache und in den Sejtenwandungen, die vierte erstreckt
sich als langer Spalt im Boden des Primordialcraniums entlang.
Von den drei oberen Öffnungen liegt die eine vorn, die beiden anderen hinter dieser und
nebeneinander. Eine y förmige Knorpelplatte trennt sie von einander.
D ie v o r d e r e ist die kleinste. Sie liegt vor der kurzen Querplatte (Taf. II Fig. 1;
Taf. V Fig. 4,5 Qpl.) u n d b i ld e t a ls r u n d l i c h e s F o r am e n im K n o r p e l d e r F r o n t
a l g e g e n d d ie Ö f fn u n g fü r d ie E p ip h y s e n (Taf. II Fig. 1; Taf. IV Fig. 1, 2, 3 Fp.).
Auf sie komme ich im zweiten Teile der Arbeit bei der Schilderung dieser Organe zurück.
gäijjSie b e id e n h i n t e r e n sind bedeutend grösser. Sie liegen zu beiden Seiten der dem
Scheitel entlang ziehenden, sich nach hinten verjüngenden Längsplatte (Taf. I Fig. 4, 5, 6 Lpl.)
und erstrecken sich caudalwärts über das Dach und den oberen Teil der Seitenwandung bis
in die Gegend der hinteren Mittelhirnregion (Taf. I Fig. 4, 5, 6 F, F.). Diese beiden Lücken
im S c h ä d e l d a c h d e s A r g y r p p e l e c u s s in d g e n e t i s c h m it d e r d u r c h R ü c k b
i ld u n g d e s P r im o r d i a l c r a n iu m s b e i G a n o id e n u n d T e l e o s t i e r n a u f t r e t e n d
e n s o g e n a n n t e n F o n t a n e l l e id e n t i s c h , die als eine einheitliche Öffnung sich über
den Scheitel des Craniums erstreckt. Sagemehl (1885 pag. 41) beschreibt bei den Characiniden
neben der Epiphysarlücke jenes grosse „Fenster“, das auch er für eine Neubildung hält, „welcher
nichts bei niederen Formen Vorkommendes an die Seite gestellt werden kann“. Bald
darauf wies dieser Forscher (1891 pag. 511) das Vorhandensein der Fontanelle auch im Primordialschädel
der Cypriniden nach.
B e i A r g y r o p e l e c u s h a t d e r R e d u k t i o n s p r o z e s s am C r a n ium o ffen b a r
n o c h n i c h t so g r o s s e F o r t s c h r i t t e g em a c h t^ w ie b e i a n d e r e n K n o c h e n f
i s c h e n , w o f ü r d a s B e s t e h e n b l e i b e n j e n e r L ä n g s p l a t t e s p r i c h t , die sich bei
Barbus (Sagemehl 1891 pag. 511) nur noch andeutungsweise als die in die Fontanelle hineinragende
Spitze jener V förmigen Epiphysarspange zu erkennen giebt. Es beginnt also, wie aus
den Verhältnissen bei Argyropelecus hervorgeht, der Reduktionsprozess nicht auf dem Scheitel
des Primordialcraniums, sondern in den oberen Teilen seiner Seitenwandungen.
D e r im B o d e n b e f i n d l i c h e , vorn weite, nach hinten zu enger werdende Spalt