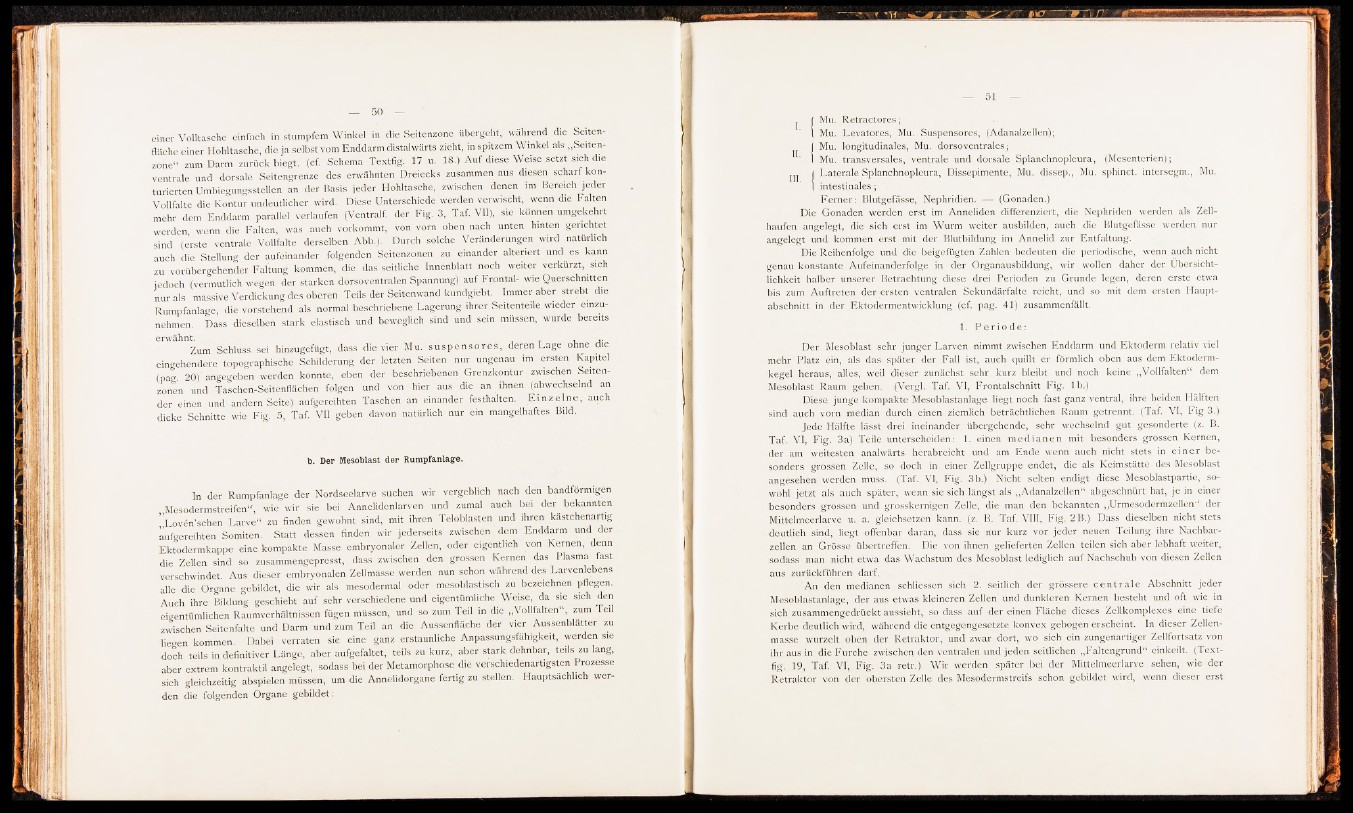
einer Volltasche einfach in stumpfem Winkel in die Seitenzone übergeht, während fflj Seitenfläche
einer Hohltasche, die ja selbst vom Enddarm distalwärts zieht, in spitzem Winkel als „Seitenzone“
zum-Darm zurück biegt. ■ Schema Textfig. 17 1 18.) Auf diese Weise,setzt sich die--
ventrale und dorsale Seitengrenze des erwähnten Dreiecks zusammen aus diesen ;i|h a r f kon-
turierten Umbiegungsstellen an der Basis jeder Hohltasche, zwischen denen im Bereich jeder
Vollfalte die Kontur undeutlicher wird. Diese Unterschiede werden verwischt, wenn die Falten
mehr dem Enddarm parallel verlaufen (Ventralf. der Fig. 3, Taf. VII), sie können umgekehrt
werden wenn die Falten, was .auch vorkommt, von vorn oben nach unten hinten gerichtet
sind (erste ventrale Vollfalte derselben Abb.). Durch solche Veränderungen wird natürlich
auch die Stellung der aufeinander folgenden Seitenzonen zu einander alteriert und es kann
zu vorübergehender Faltung kommen, die das seitliche Innenblatt no#h weiter verkürzt, sich
jedoch (vermutlich wegen der starken dorsoventralen Spannung) auf Frontal-wie Querschnitten
nur als massive Verdickung des oberen Teils der Seitenwand kundgiebt. Immer aber strebt die
Rumpfanlage, die vorstehend als normal beschriebene Lagerung ihrer Seitenteile wieder einzunehmen.
Dass dieselben stark elastisch und beweglich sind und Sein müssen, wurde bereits
erwähnt. ,.
Zum Schluss sei hinzugefügt, dass die vier Mu. s u s p e n s o r e s , deren Lage ohne die
eingehendere topographische Schilderung der letzten Seiten nur ungenau im ersteh Kapitel
(paa 20) angegeben werden konnte, ¿eben der beschriebenen Grenzkontur zwischen.^©ten-
zonen und ‘ TasChen-SeitenflJahen folgen .lind von hier aus die an ihnen (abwechselnd an
der einen und ändern Seite) aufgereihten Taschen an einander festhalten. | | | | n z e l n e , auch
dicke Schnitte wie Fig. 5, Taf. VII geben davon natürlich nur ein mangelhaftes Bild; -
b. Der Mesoblast der Rumpfanlagre.
In der Rumpfanlage der Nordseelarve suchen wir vergeblich nach den bandförmigen
Mesodermstreifen“, wie wir: ;sie Bei Annelidenlarven und zumal aich bèi der gek an n ten
’’Lovén’schen Larve“ zu finden gewohnt- sind, mit ihren Teloblasten und ihren kastchenartig
äufgereihten Somiten. Statt dessen finden wir jederseits zwischen dem Enddarm und der
Ektodermkappe eine kompakte Masse embryonaler Zellen, oder eigentlich von Kernen, denn
die Zellen sind so 'zusammengepfèsst, dass zwischen den grossen Kernen das Plasma fast
verschwindet. Aus dieser embryonalen Zellmasse werden nun schon während des Larvenlebens
alle die Organe gebildet, die wir als mesodermal oder mesoblastisch zu bezeichnen pflegen.
Auch ihre Bildung geschieht auf gehr verschiedene und eigentümliche Weise, da sie sich den
eigentümlichen Raumverhältnissen fügen müssen, und sö zum Teil in die JB llfalten“, zum-Tei
zwischen Seitenfalte und Darm und zum Teil an die Aussenfläche der vier Aussenblätter zu
liegen kommen. Dabei verraten sie eine ganz erstaunliche Anpassungsfähigkeit, werden sie
doch teils in definitiver Länge, aber aufgefaltet, teils zu kurz, aber stark dehnbar, teils zu lang,
aber extrem kontraktil angelegt, sodass bei der Metamorphose die verschiedenartigsten Prozesse
sich gleichzeitig abspielen müssen, um die Annelidörgane fertig zu stellen. Hauptsächlich werden
die folgenden Organe gebildet:
j J Mu. Retractores;
1 Mu. Levatores, Mu. Suspensores, (Adanalzellen);
Í Mu. longitudinales, Mu. dorsoventrales;
I Mu. transversales, ventrale und dorsale Splanchnopleura, (Mesenterien) ;
jjj | Laterale Splanchnopleura, Dissepimente, Mu. dissep., Mu. sphinct. intersegm., Mu.
I intestinales;
Ferner: Blutgefässe, Nephridien. — (Gonaden.)
Die Gonaden werden erst im Anneliden differenziert, die Nephriden werden als Zellhaufen
angelegt, die sich erst im Wurm weiter ausbilden, auch die Blutgefässe werden nur
angelegt und kommen erst mit der Blutbildung im Annelid zur Entfaltung.
Die Reihenfolge und die beigefügten Zahlen bedeuten die periodische, wenn auch nicht
genau konstante Aufeinanderfolge in der Organausbildung, wir wollen daher der Übersichtlichkeit
halber unserer Betrachtung diese drei Perioden zu Grunde legen, deren erste etwa
bis zum Auftreten der ersten ventralen Sekundärfalte reicht, und so mit dem ersten Hauptabschnitt
in der Ektodermentwicklung (cf. pag. 41) zusammenfällt.
1. P e r io d e :
Der Mesoblast sehr junger Larven nimmt zwischen Enddarm und Ektoderm relativ viel
mehr Platz ein, als das später der Fall ist, auch quillt er förmlich oben aus dem Ektodermkegel
heraus, alles, weil dieser zunächst sehr kurz bleibt und noch keine „Vollfalten“ dem
Mesoblast Raum geben. (Vergl. Taf. VI, Frontalschnitt Fig. Ib.)
Diese junge kompakte Mesoblastanlage liegt noch fast ganz ventral, ihre beiden Hälften
sind auch vorn median durch einen ziemlich beträchtlichen Raum getrennt. (Taf. VI, Fig 3.)
Jede Hälfte lässt drei ineinander übergehende, sehr wechselnd gut gesonderte (z. B.
Taf. VI, Fig. 3a) Teile unterscheiden: 1. einen m ed ia n e n mit besonders grossen Kernen,
der am weitesten analwärts herabreicht und am Ende wenn auch nicht stets in e in e r besonders
grossen Zelle, so doch in einer Zellgruppe endet, die als Keimstätte des Mesoblast
angesehen werden muss. (Taf. VI, Fig. 3b.) Nicht selten endigt diese Mesoblastpartie, sowohl
jetzt als auch später, wenn sie sich längst als „Adanalzellen“ abgeschnürt hat, je in einer
besonders grossen und grosskernigen Zelle, die man den bekannten „Urmesodermzellen“ der
Mittelmeerlarve u. a. gleichsetzen kann. (z. B. Taf. VIII, Fig. 2B.) Dass dieselben nicht stets
deutlich sind, liegt offenbar daran, dass sie nur kurz vor jeder neuen Teilung ihre Nachbarzellen
an Grösse übertreffen. Die von ihnen gelieferten Zellen teilen sich aber lebhaft weiter,
sodass man nicht etwa das Wachstum des Mesoblast lediglich auf Nachschub von diesen Zellen
aus zurückführen darf; ki
An den medianen schliessen sich 2. seitlich der grössere c e n tr a le Abschnitt jeder
Mesoblastanlage, der aus etwas kleineren Zellen und dunkleren Kernen besteht und oft wie in
sich zusammengedrückt aussieht, so dass auf der einen Fläche dieses Zellkomplexes eine tiefe
Kerbe deutlich wird, während die entgegengesetzte konvex gebogen erscheint. In dieser Zellenmasse
wurzelt oben der Retraktor, und zwar dort, wo sich ein zungenartiger Zellfortsatz von
ihr aus in die Furche zwrischei\ den ventralen und jeden seitlichen „Faltengrund“ einkeilt. (Text-
fio-. 19, Taf. VI, Fig. 3a retr.ju Wir werden später bei der Mittelmeerlarve sehen, wie der
Retraktor von der obersten Zelle des Mesodermstreifs schon gebildet wird, wenn dieser erst