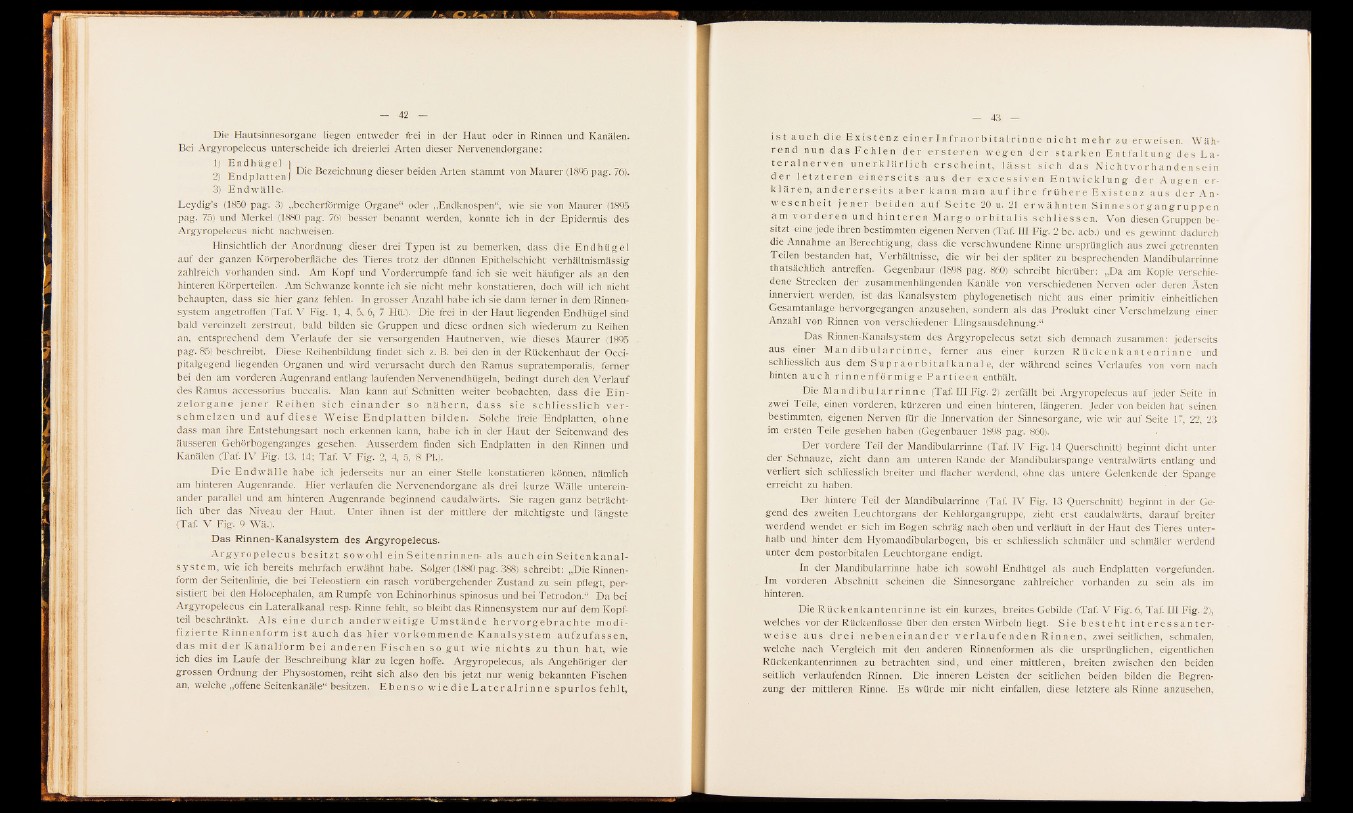
Die Hautsinnesorgane liegen entweder frei in der Haut oder in Rinnen und Kanälen.
Bei Argyropelecus unterscheide ich dreierlei Arten dieser Nervenendorgane:
1) E n d h ü g e l )
2) E n d p la tte n J Bezeichnung dieser beiden Arten stammt von Maurer (1895 pag. 76).
3) E n dw ä lle .
Leydig’s (1850 pag. 3) ^becherförmige Organe“ oder „Endknospen“, wie .sie von Maurer (1895
pag. 75) und Merkel (1880 pag. 76) besser benannt werden, konnte ich in der Epidermis des
Argyropelecus nicht nachweisen.
Hinsichtlich der Anordnung dieser drei Typen ist zu bemerken, dass die E n d h ü g e l
auf der ganzen Körperoberfläche des Tieres trotz der dünnen Epithelschicht verhältnismässig
zahlreich vorhanden sind. Am Kopf und Vorderrumpfe fand ich sie weit häufiger als an den
hinteren Körperteilen. Am Schwänze konnte ich sie nicht mehr konstatieren, doch will ich nicht
behaupten, dass sie hier ganz fehlen. In grösser Anzahl habe ich sie dann ferner in dem Rinnensystem
angetroffen (Taf. V Figv 'l, 4, 5, 6, 7 Hü.). Die frei in der Haut liegenden Endhügel sind
bald vereinzelt zerstreut, bald bilden sie Gruppen und diese ordnen sich wiederum zu Reihen
an, entsprechend dem Verlaufe der sie versorgenden Hautnerven, wie dieses Maurer (1895
pag. 85) beschreibt. Diese Reihenbildung findet sich z. B. bei den in der Rückenhaut der Ocei-
pitalgegend liegenden Organen und wird verursacht durch den Ramus supratemporalis, ferner
bei den am vorderen Augenrand entlang laufenden Nervenendhügeln, bedingt durch den Verlauf
des Ramus accessorius buccalis. Man kann auf Schnitten weiter beobachten, dass die E in z
e lo rg a n e je n e r R e ih e n s ic h e in a n d e r so n ä h e rn , d a s s sie s c h lie s s lic h v e r s
c hm e lz e n u n d a u f d ie s e Wei&e E n d p la tte n b ild en . Solche freie TEndplatten, o hne
dass man ihre Entstehungsart noch erkennen kann, habe ich in der Haut der Seitenwand des
äusseren Gehörbogenganges gesehen. Ausserdem finden sich Endplatten in den Rinnen und
Kanälen (Taf. IV Fig. 13, 14; Taf. V Fig. 2, 4, 5, 8 t 8 ^
D ie E n dw ä lle habe ich jederseits nur an einer Stelle konstatieren können, nämlich
am hinteren Augenrande. Hier verlaufen die Nervenendorgane als drei kurze Wälle untereinander
parallel und am hinteren Augenrande beginnend caudalwärts. Sie ragen ganz beträchtlich
über das Niveau der Haut. Unter ihnen ist der mittlere der mächtigste und längste
(Taf. V Fig. 9 Wä.j.
Das Rinnen-Kanalsystem des Argyropelecus.
A r g y ro p e le c u s b e s itz t sow o h l e in S e ite n rin n e n - a ls a u c h ein S e i te n k a n a lsy
s tem , wie ich bereits mehrfach erwähnt habe. Solger (1880 pag. 388) schreibt: „Die Rinnenform
der Seitenlinie, die bei Teleostiem ein rasch vorübergehender Zustand zu sein pflegt, per-
sistiert bei den Holocephalen, am Rumpfe von Echinorhinus spinosus und bei Tetrodon.“ Da bei
Argyropelecus ein Lateralkanal resp. Rinne fehlt, so bleibt das Rinnensystem nur auf dem Kopfteil
beschränkt. Als e in e d u r c h a n d e rw e itig e U m s tä n d e h e r v o r g e b r a c h t e m o d if
iz ie r te R in n e n fo rm i s t a u c h d a s h ie r v o rk om m e n d e K a n a ls y s tem a u f z u f a s s e n ,
d a s m it d e r K a n a lfo rm b e i a n d e r e n F is c h e n so g u t wie n ic h ts zu th u n h a t, wie
ich dies im Laufe der Beschreibung klar zu legen hoffe. Argyropelecus, als Angehöriger der
grossen Ordnung der Physostomen, reiht sich also den bis jetzt nur wenig bekannten Fischen
an, welche „offene Seitenkanäle“ besitzen. E b e n s o w ie d ie L a t e r a l r i n n e sp u r lo s fehlt,
i s t a u c h d ie E x i s t e n z e in e r I n f r a o r b i t a l r i n n e n i c h t m e h r zu erweisen . W äh r
e n d n u n d a s F e h l e n d e r e r s t e r e n w e g e n d e r s t a r k e n E n t f a l t u n g d e s L a t
e r a l n e r v e n u n e r k l ä r l i c h e r s c h e i n t , l ä s s t s ic h d a s N i c h tv o r h a n d e n s e i n
d e r l e t z t e r e n e i n e r s e i t s a u s d e r e x c e s s iv e n E n tw i c k lu n g d e r A u g e n e r k
l ä r e n , a n d e r e r s e i t s a b e r k a n n m an a u f ih r e f r ü h e r e E x i s t e n z a u s d e r A n w
e s e n h e i t j e n e r b e id e n a u f S e i te 20 u. 21 e rw ä h n t e n S i n n e s o r g a n g r u p p e n
am v o r d e r e n u n d h i n t e r e n M a rg o o r b i t a l i s s c hl i e s s e n. Von diesen Gruppen besitzt
eine jede ihren bestimmten eigenen Nerven (Taf. III Fig. 2 bc. acb.) und es gewinnt dadurch
die Annahme an Berechtigung, dass die verschwundene Rinne ursprünglich aus zwei getrennten
Teilen bestanden hat, Verhältnisse, die wir bei der später zu besprechenden Mandibularrinne
thatsächlich antreffen. Gegenbaur (1898 pag. 860) Schreibt hierüber: „Da am Kopfe verschiedene
Strecken der zusammenhängenden Kanäle von verschiedenen Nerven oder deren Ästen
innerviert werden, ist das Kanalsystem phylogenetisch nicht aus einer primitiv einheitlichen
Gesamtanlage hervorgegangen anzusehen, sondern als das Produkt einer Verschmelzung einer
Anzahl von Rinnen von verschiedener Längsausdehnung.“
Das Rinnen-Kanalsystem des Argyropelecus setzt sich demnach zusammen: jederseits
aus einer M a n d i b u l a r r in n e , ferner aus einer kurzen R ü c k e n k a n t e n r i n n e und
schliesslich aus dem S u p r a o r b i t a l k a n a l e , der während seines Verlaufes von vorn nach
hinten a u c h r in n e n f ö rm ig e P a r t i e e n enthält.
Die M a n d ib u l a r r in n e |Taf. III Fig. 2) zerfällt bei Argyropelecus auf jeder Seite in
zwei Teile, einen vorderen, kürzeren und einen hinteren, längeren. Jeder von beiden hat seinen
bestimmten, eigenen Nerven für die Innervation der Sinnesorgane, wie wir auf Seite 17, 22, 23
im ersten Teile gesehen haben (Gegenbauer 1898 pag. 860).
Der vordere Teil der Mandibularrinne (Taf. IV Fig. 14 Querschnitt) beginnt dicht unter
der Schnauze, zieht dann am unteren Rande der Mandibularspange ventralwärts entlang und
verliert sich schliesslich breiter und flacher werdend, ohne das untere Gelenkende der Spange
erreicht zu haben.
Der hintere Teil der Mandibularrinne (Taf. IV Fig. 13 Querschnitt) beginnt in der Gegend
des zweiten Leuchtorgans der Kehlorgangruppe, zieht erst caudalwärts, darauf breiter
werdend wendet er Sich im Bogen schräg nach oben und verläuft in der Haut des Tieres unterhalb
und hinter dem Hyomandibularbogen, bis er schliesslich schmäler und schmäler werdend
unter dem postorbitalen Leuchtorgane endigt.
In der Mandibularrinne habe ich sowohl Endhügel als auch Endplatten vorgefunden.
Im vorderen Abschnitt scheinen die Sinnesorgane zahlreicher vorhanden zu sein als im
hinteren.
Die R ü c k e n k a n te n rin n e ist ein kurzes, breites Gebilde (Taf. V Fig. 6, Taf. III Fig. 2),
welches vor der Rückenflosse über den ersten Wirbeln liegt. S ie b e s t e h t i n t e r e s s a n t e r w
e is e a u s d r e i n e b e n e in a n d e r v e r l a u f e n d e n R in n e n , zwei seitlichen, schmalen,
welche nach Vergleich mit den anderen Rinnenformen als die ursprünglichen, eigentlichen
Rückenkantenrinnen zu betrachten sind, und einer mittleren, breiten zwischen den beiden
seitlich verlaufenden Rinnen. Die inneren Leisten der seitlichen beiden bilden die Begrenzung
der mittleren Rinne. Es würde mir nicht einfallen, diese letztere als Rinne anzusehen,