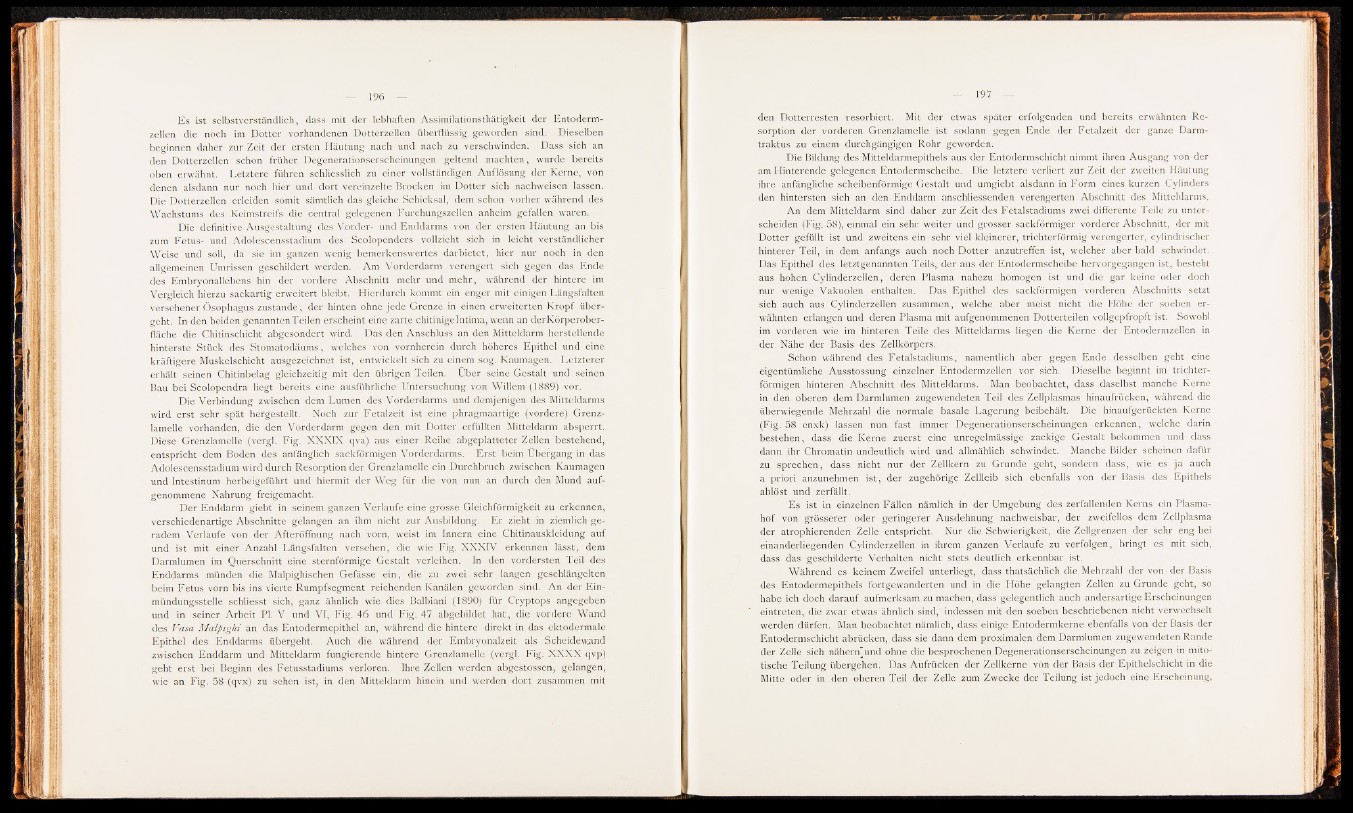
Es ist selbstverständlich, dass mit der lebhaften Assimilationsthätigkeit der Entoderm-
zellen die noch im Dotter vorhandenen Dotterzellen überflüssig geworden sind. Dieselben
beginnen daher zur Zeit der ersten Häutung nach und nach zu verschwinden. Dass sich an
den Dotterzellen schon früher Degenerationserscheinungen geltend machten, wurde bereits
oben erwähnt. Letztere führen schliesslich zu einer vollständigen Auflösung der Kerne, von
denen alsdann nur noch hier und dort vereinzelte Brocken im Dotter sich nachweisen lassen.
Die Dotterzellen erleiden somit sämtlich das gleiche Schicksal, dem schon vorher während des
Wachstums des Keimstreifs die central gelegenen Furchungszellen anheim gefallen waren.
Die definitive Ausgestaltung des Vorder- und Enddarms von der ersten Häutung an bis
zum Fetus- und Adolescensstadium des Scolopenders vollzieht sich in leicht verständlicher
Weise und soll, da sie im ganzen wenig bemerkenswertes darbietet, hier nur noch in den
allgemeinen Umrissen geschildert werden. Am Vorderdarm verengert sich gegen das Ende
des Embryonallebens hin der vordere Abschnitt mehr und mehr, während der hintere im
Vergleich hierzu sackartig erweitert bleibt. Hierdurch kommt ein enger mit einigen Längsfalten
versehener Ösophagus zustande, der hinten ohne jede Grenze in einen erweiterten Kropf übergeht.
In den beiden genannten Teilen erscheint eine zarte chitinige Intima, wenn an der Körperoberfläche
die Chitinschicht abgesondert wird. Das den Anschluss an den Mitteldarm herstellende
hinterste Stück des Stomatodäums, welches von vornherein durch höheres Epithel und eine
kräftigere Muskelschicht ausgezeichnet ist, entwickelt sich zu einem sog. Kaumagen. Letzterer
erhält seinen Chitinbelag gleichzeitig mit den übrigen Teilen. Über seine Gestalt und seinen
Bau bei Scolopendra liegt bereits eine ausführliche Untersuchung von Willem (1889) vor.
Die Verbindung zwischen dem Lumen des Vorderdarms und demjenigen des Mitteldarms
wird erst sehr spät hergestellt. Noch zur Fetalzeit ist eine phragmaartige (vordere) Grenzlamelle
vorhanden, die den Vorderdarm .gegen den mit Dotter erfüllten Mitteldarm absperrt.
Diese Grenzlamelle (vergl. Fig. XXXIX qva) aus einer Reihe abgeplatteter Zellen bestehend,
entspricht dem Boden des anfänglich sackförmigen Vorderdarms. Erst beim Übergang in das
Adolescensstadium wird durch Resorption der Grenzlamelle ein Durchbruch zwischen Kaumagen
und Intestinum herbeigeführt und hiermit der Weg für die vo.n nun an durch den Mund aufgenommene
Nahrung freigemacht.
Der Enddarm giebt in seinem ganzen Verlaufe eine grosse Gleichförmigkeit zu erkennen,
verschiedenartige Abschnitte gelangen an ihm nicht zur Ausbildung. Er zieht in ziemlich geradem
Verlaufe von der Afteröffnung nach vorn, weist im Innern eine Chitinauskleidung auf
und ist mit einer Anzahl Längsfalten versehen, die wie Fig. XXXIV erkennen lässt, dem
Darmlumen im Querschnitt eine sternförmige Gestalt verleihen. In den vordersten Teil des
Enddarms münden die Malpighischen Gefässe ein, die zu zwei sehr langen geschlängelten
beim Fetus vorn bis ins vierte Rumpfsegment reichenden Kanälen geworden sind. An der Einmündungsstelle
schliesst sich, ganz ähnlich wie dies Balbiani (1890) für Cryptops angegeben
und in seiner Arbeit PI. V und VI, Fig. 46 und Fig. 47 abgebildet hat, die vordere Wand
des Vasa Malpighi an das Entodermepithel an, während die hintere direkt in das ektodermale
Epithel des Enddarms übergeht. Auch die während der Embryonalzeit als Scheidewand
zwischen Enddarm und Mitteldarm fungierende hintere Grenzlamelle (vergl. Fig. XXXX qvp)
geht erst bei Beginn des Fetusstadiums verloren. Ihre Zellen werden abgestossen, gelangen,
wie an Fig. 58 (qvx) zu sehen ist, in den Mitteldarm hinein und werden dort zusammen mit
den Dotterresten resorbiert. Mit der etwas später erfolgenden und bereits erwähnten Resorption
der vorderen Grenzlamelle ist sodann gegen Ende der Fetalzeit der ganze Darm-
traktus zu einem durchgängigen Rohr geworden.
Die Bildung des Mitteldarmepithels aus der Entodermschicht nimmt ihren Ausgang von der
am Hinterende gelegenen Entodermscheibe. Die letztere verliert zur Zeit der zweiten Häutung
ihre anfängliche scheibenförmige Gestalt und umgiebt alsdann in Form eines kurzen Cylinders
den hintersten sich an den Enddarm anschliessenden verengerten Abschnitt des Mitteldarms.
An dem Mitteldarm sind daher zur Zeit des Fetalstadiums zwei differente Teile zu unterscheiden
(Fig. 58), einmal ein sehr weiter und grösser sackförmiger vorderer Abschnitt, der mit
Dotter gefüllt ist und zweitens ein sehr viel kleinerer, trichterförmig verengerter, cylindrischer
hinterer Teil, in dem anfangs auch noch Dotter anzutreffen ist, welcher aber bald schwindet.
Das Epithel des letztgenannten Teils, der aus der Entodermscheibe hervorgegangen ist, besteht
aus hohen Cylinderzellen, deren Plasma nahezu homogen ist und die gar keine oder doch
nur wenige Vakuolen enthalten. Das Epithel des Sackförmigen vorderen Abschnitts setzt
sich auch aus Cylinderzellen zusammen, welche aber meist nicht die Höhe der soeben erwähnten
erlangen und deren Plasma mit aufgenommenen Dotterteilen vollgepfropft ist. Sowohl
im vorderen wie im hinteren Teile des Mitteldarms liegen die Kerne der Entodermzellen in
der Nähe der Basis des Zellkörpers.
Schon während des Fetalstadiums, namentlich aber gegen Ende desselben geht eine
eigentümliche Ausstossung einzelner Entodermzellen vor sich. Dieselbe beginnt im trichterförmigen
hinteren Abschnitt des Mitteldarms. Man beobachtet, dass daselbst manche Kerne
in den oberen dem Darmlumen zugewendeten Teil des Zellplasmas hinaufrücken, während die
überwiegende Mehrzahl die normale basale Lagerung beibehält. Die hinaufgerückten Kerne
(Fig. 58 enxk) lassen nun fast immer Degenerationserscheinungen erkennen, welche darin
bestehen, dass die Kerne zuerst eine unregelmässige zackige Gestalt bekommen und dass
dann ihr Chromatin undeutlich wird und allmählich schwindet. Manche Bilder scheinen dafür
zu sprechen, dass nicht nur der Zellkern zu Grunde geht, sondern dass, wie es ja auch
a priori anzunehmen ist, der zugehörige Zellleib sich ebenfalls von der Basis des Epithels
ablöst und zerfällt.
Es ist in einzelnen Fällen nämlich in der Umgebung des zerfallenden Kerns ein Plasmahof
von grösserer oder geringerer Ausdehnung nachweisbar, der zweifellos dem Zellplasma
der atrophierenden Zelle entspricht. Nur die Schwierigkeit, die Zellgrenzen der sehr eng bei
einanderliegenden Cylinderzellen in ihrem ganzen Verlaufe zu verfolgen, bringt es mit sich,
dass das geschilderte Verhalten nicht stets deutlich erkennbar ist.
Während es keinem Zweifel unterliegt, dass thatsächlich die Mehrzahl der von der Basis
des Entodermepithels fortgewanderten und in die Höhe gelangten Zellen zu Grunde geht, so
habe ich doch darauf aufmerksam zu machen, dass gelegentlich auch andersartige Erscheinungen
eintreten, die zwar etwas ähnlich sind, indessen mit den soeben beschriebenen nicht verwechselt
werden dürfen. Man beobachtet nämlich, dass einige Entodermkerne ebenfalls von der Basis der
Entodermschicht abrücken, dass sie dann dem proximalen dem Darmlumen zugewendeten Rande
der Zelle sich näherff und ohne die besprochenen Degenerationserscheinungen zu zeigen in mitotische
Teilung übergehen. Das Aufrücken der Zellkerne von der Basis der Epithelschicht in die
Mitte oder in den oberen Teil der Zelle zum Zwecke der Teilung ist jedoch eine Erscheinung,