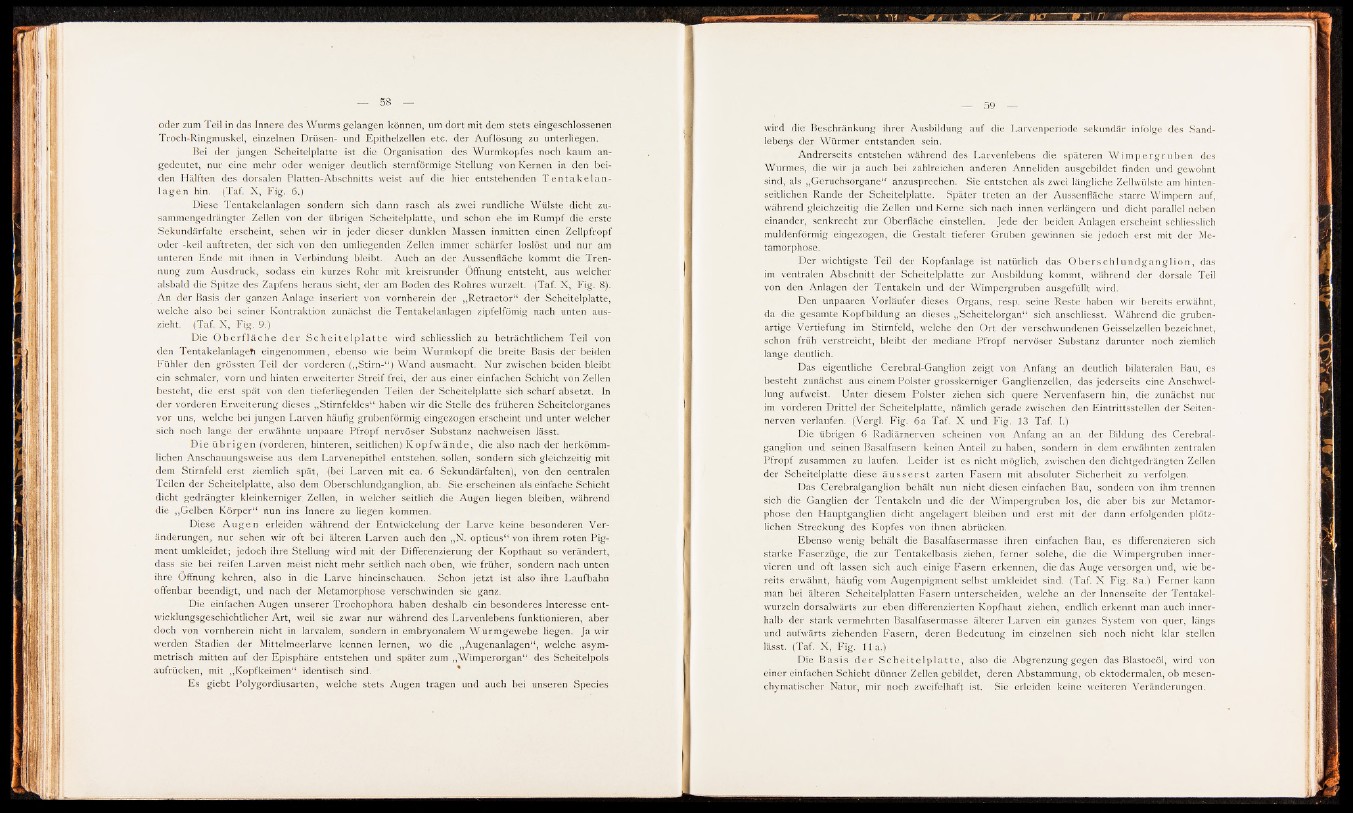
oder zum Teil in das Innere des Wurms gelangen können, um dort mit dem stets eingeschlossenen
Troch-Ringmuskel, einzelnen Drüsen- und Epithelzellen etc. der Auflösung zu unterliegen.
Bei der jungen Scheitelplatte ist die Organisation des Wurmkopfes noch kaum angedeutet,
nur eine mehr oder weniger deutlich sternförmige Stellung von Kernen in den beiden
Hälften des dorsalen Platten-Abschnitts weist auf die hier entstehenden T e n t a k e l a n la
g e n hin. (Taf. X, Fig. 6.)
Diese Tentakelanlagen sondern sich dann rasch als zwei rundliche Wülste dicht zusammengedrängter
Zellen von der übrigen Scheitelplatte, und schon ehe im Rumpf die erste
Sekundärfalte erscheint, sehen wir in jeder dieser dunklen Massen inmitten einen Zellpfropf
oder -keil auftreten, der sich von den umliegenden Zellen immer schärfer loslöst und nur am
unteren Ende mit ihnen in Verbindung bleibt. Auch an der Aussenfläche kommt die Trennung
zum Ausdruck, sodass ein kurzes Rohr mit kreisrunder Öffnung entsteht, aus welcher
alsbald die Spitze des Zapfens heraus sieht, der am Boden des Rohres wurzelt. (Taf. X, Fig. 8).
An der Basis der ganzen Anlage inseriert von vornherein der „Retractor“ der Scheitelplatte,
welche also bei seiner Kontraktion zunächst die Tentakelanlagen zipfelfömig nach unten auszieht.
(Taf. X, Fig. 9.)
Die O b e r f lä c h e d e r S c h e it e lp l a t t e wird schliesslich zu beträchtlichem Teil von
den Tentakelanlageti eingenommen, ebenso wie beim Wurmkopf die breite Basis der beiden
Fühler den grössten Teil der vorderen („Stirn-“) Wand ausmacht. Nur zwischen beiden bleibt
ein schmaler, vorn und hinten erweiterter Streif frei, der aus einer einfachen Schicht von Zellen
besteht, die erst spät von den tieferliegenden Teilen der Scheitelplatte sich scharf absetzt. In
der vorderen Erweiterung dieses „Stirnfeldes“ haben wir die Stelle des früheren Scheitelorganes
vor uns, welche bei jungen Larven häufig grubenförmig eingezogen erscheint und unter welcher
sich noch lange der erwähnte unpaare Pfropf nervöser Substanz nachweisen lässt.
Die ü b r ig e n (vorderen, hinteren, seitlichen) K o p fw än d e , die also nach der herkömmlichen
Anschauungsweise aus dem Larvenepithel entstehen, sollen, sondern sich gleichzeitig mit
dem Stirnfeld erst ziemlich spät, (bei Larven mit ca. 6 Sekundärfalten), von den centralen
Teilen der Scheitelplatte, also dem Oberschlundganglion, ab. Sie erscheinen als einfache Schicht
dicht gedrängter kleinkerniger. Zellen, in welcher seitlich die Augen liegen bleiben, während
die „Gelben Körper“ nun ins Innere zu liegen kommen.
Diese A u g en erleiden während der Entwickelung der Larve keine besonderen Veränderungen,
nur sehen wir oft bei älteren Larven auch den „N. opticus“ von ihrem roten Pigment
umkleidet; jedoch ihre Stellung wird mit der Differenzierung der Kopthaut so verändert,
dass sie bei reifen Larven meist nicht mehr seitlich nach oben, wie früher, sondern nach unten
ihre Öffnung kehren, also in die Larve hineinschauen. Schon jetzt ist also ihre Laufbahn
offenbar beendigt, und nach der Metamorphose verschwinden sie ganz.
Die einfachen-Augen unserer Trochophora haben deshalb ein besonderes Interesse entwicklungsgeschichtlicher
Art, weil sie zwar nur während des Larvenlebens funktionieren, aber
doch von vornherein nicht in larvalem, sondern in embryonalem Wurmgewebe liegen. Ja wir
werden Stadien der Mittelmeerlarve kennen lernen, wo die „Augenanlagen“, welche asymmetrisch
mitten auf der Episphäre entstehen und später zum „Wimperorgan“ des Scheitelpols
aufrücken, mit „Kopfkeimen“ identisch sind.
Es giebt Polygordiusarten, welche stets Augen tragen und auch bei unseren Species
wird die Beschränkung ihrer Ausbildung auf die Larvenperiode sekundär infolge des Sand-
lebei^s der Würmer entstanden sein.
Andrerseits entstehen während des Larvenlebens die späteren W im p e rg ru b e n des
Wurmes, die wir ja auch bei zahlreichen anderen Anneliden ausgebildet finden und gewohnt
sind, als „Geruchsorgane“ anzusprechen. Sie entstehen als zwei längliche Zellwülste am hintenseitlichen
Rande der Scheitelplatte. Später treten an der Aussenfläche starre Wimpern auf,
während gleichzeitig die Zellen und Kerne sich nach innen verlängern und dicht parallel neben
einander, senkrecht zur Oberfläche einstellen. Jede der beiden Anlagen erscheint schliesslich
muldenförmig eingezogen, die Gestalt tieferer Gruben gewinnen sie jedoch erst mit der Metamorphose.
Der wichtigste Teil der Kopfanlage ist natürlich das O b e rs c h lu n d g a n g lio n , das
im ventralen Abschnitt der Scheitelplatte zur Ausbildung kommt, während der dorsale Teil
von den Anlagen der Tentakeln und der Wimpergruben ausgefüllt wird.
Den unpaaren Vorläufer dieses Organs, resp. seine Reste haben wir bereits erwähnt,
da die gesamte Kopfbildung an dieses „Scheitelorgan“ sich anschliesst. Während die grubenartige
Vertiefung im Stirnfeld, welche den Ort der verschwundenen Geisselzellen bezeichnet,
schon früh verstreicht, bleibt der mediane Pfropf nervöser Substanz darunter noch ziemlich
lange deutlich.
Das eigentliche Cerebral-Ganglion zeigt von Anfang an deutlich bilateralen Bau, es
besteht zunächst aus einem Polster grosskerniger Ganglienzellen, das jederseits eine Anschwellung
aufweist. Unter diesem Polster ziehen sich quere Nervenfasern hin, die zunächst nur
im vorderen Drittel der Scheitelplatte, nämlich gerade zwischen den Eintrittsstellen der Seitennerven
verlaufen. (Vergl. Fig. 6a Taf. X und Fig. 13 Taf. I.)
Die übrigen 6 Radiärnerven scheinen von Anfang an an der Bildung des Cerebralganglion
und seinen Basalfasern keinen Anteil zu haben, sondern in dem erwähnten zentralen
Pfropf zusammen zu laufen. Leider ist es nicht möglich, zwischen den dichtgedrängten Zellen
der Scheitelplatte diese ä u s s e r s t zarten Fasern mit absoluter Sicherheit zu verfolgen.
Das Cerebralganglion behält nun nicht diesen einfachen Bau, sondern von ihm trennen
sich die Ganglien der Tentakeln und die der Wimpergruben los, die aber bis zur Metamorphose
den Hauptganglien dicht angelagert bleiben und erst mit der dann erfolgenden plötzlichen
Streckung des Kopfes von ihnen abrücken.
Ebenso wenig behält die Basalfasermasse ihren einfachen Bau, es differenzieren sich
starke Faserzüge, die zur Tentakelbasis ziehen, ferner solche, die die Wimpergruben innervieren
und oft. lassen sich auch einige Fasern erkennen, die das Auge versorgen und, wie bereits
erwähnt, häufig vom Augenpigment selbst umkleidet sind. (Taf. X Fig. 8 a.) Ferner kann
man bei älteren Scheitelplatten Fasern unterscheiden, welche an der Innenseite der Tentakelwurzeln
dorsalwärts zur eben differenzierten Kopfhaut ziehen, endlich erkennt man auch innerhalb
der stark vermehrten Basalfasermasse älterer Larven ein ganzes System von quer, längs
und aufwärts ziehenden Fasern, deren Bedeutung im einzelnen sich noch nicht klar stellen
lässt. (Taf. X, Fig. 11a.)
Die B a sis d e r S c h e it e lp l a t t e , also die Abgrenzung gegen das Blastocöl, wird von
einer einfachen Schicht dünner Zellen gebildet, deren Abstammung, ob ektodermalen, ob mesen-
chymatischer Natur, mir noch zweifelhaft ist. Sie erleiden keine weiteren Veränderungen.