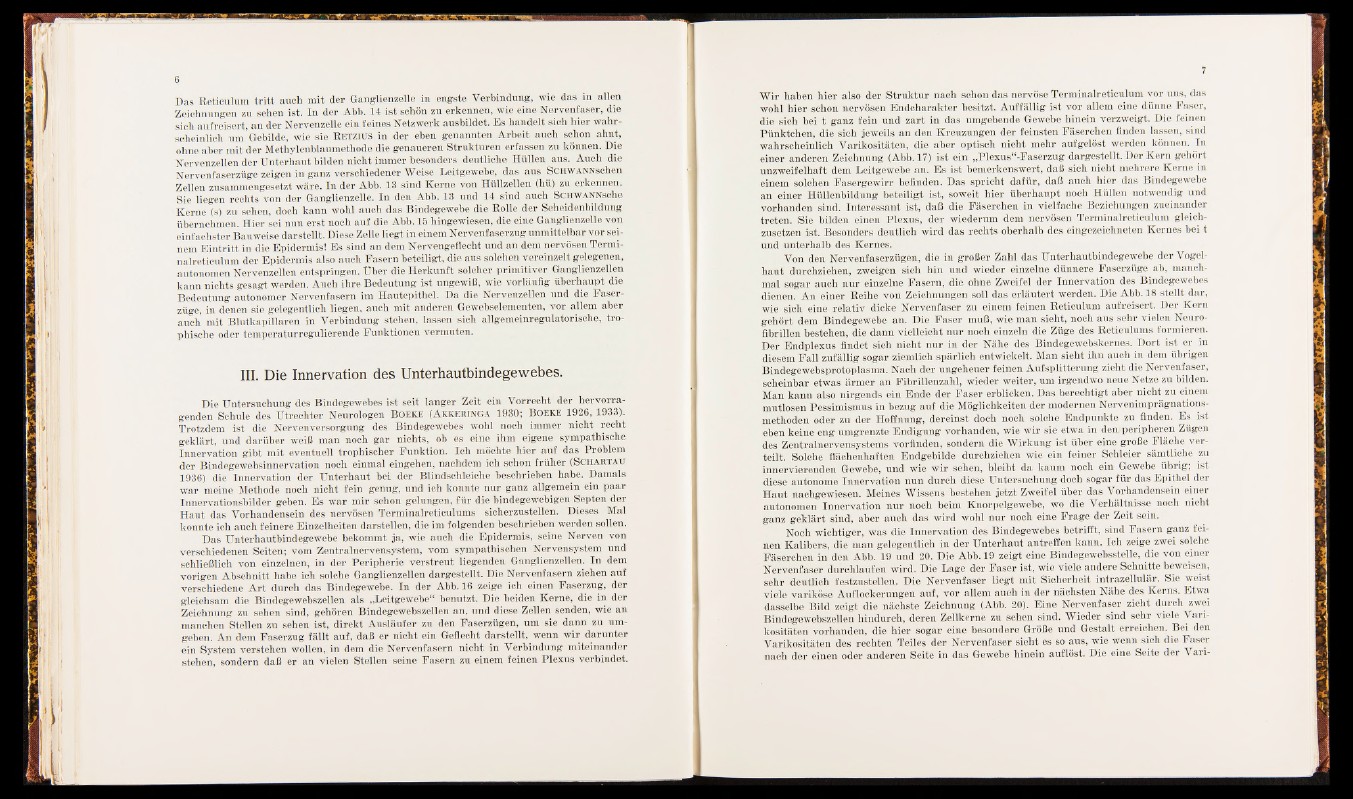
Das Retieulum tr itt auch mit der Ganglienzelle in engste Verbindung, wie das in allen
Zeichnungen zu sehen ist. In der Abh. 14 ist schön zu erkennen, wie eine Nervenfaser, die.
sich aufreisert, an der Nervenzelle ein feines Netzwerk ausbildet. Es handelt sich hier wahrscheinlich
um Gebilde, wie sie RETZlüS.in der eben genannten Arbeit auch schon ahnt,
ohne aber mit der Methylenblaumethode die genaueren Strukturen erfassen zu können. Die
Nervenzellen der U nterhaut bilden nicht immer besonders deutliche Hüllen aus. Auch die
Nervenfaserzüge zeigen in ganz verschiedener Weise Leitgewebe, das aus SCHWANNscben
Zellen zusammengesetzt wäre. In der Abb. 13 sind Kerne von Hüllzellen (hü) zu erkennen.
Sie liegen rechts von der Ganglienzelle. In den Abb, .13 und 14 sind auch ScuvvANNsche
Kerne (s) zu sehen, doch kann wohl auch das Bindegewebe die Rolle der Scheidenbildung
übernehmen. Hier sei nun erst noch auf die Abb. 15 hingewiesen, die eine Ganglienzelle von
einfachster Bauweise darstellt. Diese Zelle liegt in einem Nervenfaserzug unmittelbar vor seinem
E in tritt in die Epidermis! Es sind an dem Nervengeflecht und an dem nervösen Termi-
nalreticulum der Epidermis also auch Fasern beteiligt, die aus solchen vereinzelt gelegenen,
autonomen Nervenzellen entspringen. Über die Herkunft solcher primitiver Ganglienzellen
kann nichts gesagt werden. Auch ihre Bedeutung ist ungewiß, wie: vorläufig überhaupt d i |;
Bedeutung autonomer Nervenfasern im Haütepithel. Da die Nervenzellen und die Faserzüge,
in denen sie gelegentlich liegen, auch mit anderen Gewebselementen, vor allem aber
auch mit Blutkapillaren in Verbindung stehen, lassen sich allgemeinregulatorische, tro-
phische oder temperaturregulierende Funktionen vermuten.
III. Die Innervation des Unterhautbindegewebes.
Die Untersuchung des Bindegewebes ist seit langer Zeit ein Vorrefht der hervorragenden
Schute’ des Utreehter Neurologen BoÉKE (Akkekinga1|930:; BoeKE 1926, 1 9 M |
Trotzdem ist die Nervenversorgung des Bindegewebes wohl noch immer nicht H e h t
geklärt, und darüber weiß man noch gar nichts, ob es eine ihm eigene sympathische
Innervation gibt mit eventuell trophischer Funktion. Ich möchte hier auf das Problem
der Bindegewebsinnervation noch einmal eingehen, nachdem ich schon früher (Schartau
1936) die Innervation der Unterhaut bei der Blindschleiche beschrieben habe. Damals
war meine Methode noch nicht fein genug, und ich konnte nur ganz allgemein ein paar
Innervationsbilder geben. Es war mir schon gelungen, fü r die bindegewebigen Septen der
Haut das Vorhandensein des nervösen Terminalreticulums sicherzustellen. Dieses Mal
konnte ich auch feinere Einzelheiten darstellen, die im folgenden beschrieben werden sollen.
Das Unterhautbindegewebe bekommt ja, wie auch die Epidermis, seine Nerven von
verschiedenen Seiten; vom Zentralnervensystem, vom sympathischen Nervensystem und
schließlich von einzelnen, in der Peripherie verstreut liegenden Ganglienzellen. In dem
vorigen Abschnitt habe ich solche Ganglienzellen dargestellt. Die Nervenfasern ziehen auf
verschiedene A rt durch das Bindegewebe. In der Abb. 16 zeige ich einen Faserzug, der
gleichsam die Bindegewebszellen als „Leitgewebe“ benutzt. Die beiden Kerne, die in der
Zeichnung zu sehen sind, gehören Bindegewebszellen an, und diese Zellen senden, wie an
manchen Stellen zu sehen ist, direkt Ausläufer zu den Faserzügen, um sie dann zu umgeben.
An dem Faserzug fällt auf, daß er nicht ein Geflecht darstellt, wenn wir darunter
ein System verstehen wollen, in dem die Nervenfasern nicht in Verbindung miteinander
stehen, sondern daß er an vielen Stellen seine Fasern zu einem feinen Plexus verbindet.
Wir haben hier also der Struktur hach schon das nervöse Terminalreticulum vor uns, das
wohl hier schon nervösen Endcharakter besitzt. Auffällig ist vor allem eine dünne Faser,
die sich bei t ganz fein und zart in das umgebende Gewebe hinein verzweigt. Die feinen
Pünktchen, die sich jeweilpan den Kreuzungen der feinsten Fäserchen finden lassen, sind
wahrscheinlich Varikositäten, die aber optisch nicht mehr aufgelöst werden können. In
einer anderen Zeichnung (Abb. 17) ist ein „Plexus4’ Faserzug dargestellt. Der Kern gehört
unzweifelhaft dem Leitgewebe il*'. Es ist bemerkenswert, daß sich nicht mehrere Kerne in
einem solchen Fasergewirr befinden. Das spricht dafür, daß auch hier das Bindegewebe
an einer Hüllenbildung beteiligt ist, soweit hier überhaupt noch Hüllen notwendig und
vorhanden sind. Interessant ist, daß die Fäserchen in vielfache Beziehungen zueinander
treten. Sie bildedf^einen Plexus, der wiederum dem nervösen Terminalreticulum gleich-
zusetzenlst. Besonders deutlich wird das rechts oberhalb des eingezeichneten Kernes bei t
und unterhalb des Kernes.
Von den Nervenfaserzügen, die in großer Zahl das Unterhauthindegewebe der Vogelhaut
durchziehen, zweigen sich hin und wieder einzelne dünnere Faserzüge ab, manchmal
sogar auch n ur einzelne Fasern, die ohne Zweifel der Innervation des Bindegewebes
dienen. An einer Reihe von Zeichnungen soll das erläutert werden. Die Abb. 18 stellt dar,
wie sich eine relativ dicke Nervenfaser zu einem feinen Retieulum aufreisert. Der Kern
gehört dem Bindegewebe an. Die Faser muß, wie man sieht, noch aus sehr vielen Neurofibrillen
bestehen, die dann vielleicht nur noch einzeln die Züge des Reticulums formieren.
Der Endplexus findet sich nicht nur in der Nähe des Bindegewebskernes. Dort ist er in
diesem Fall zufällig sogar ziemlich spärlich entwickelt. Man sieht ihn auch in dem übrigen
Bindegewebsprotoplasma. Nach der ungeheuer feinen Aufsplitterung zieht die Nervenfaser,
scheinbar etwas ärmer an Fibrillenzahl, wieder weiter, um irgendwo neue Netze zu bilden.
Man kann also nirgends ein Ende der Faser erblicken. Das berechtigt aber nicht, zu einem
mutlosen Pessimismus in bezug auf die Möglichkeiten der modernen Nervenimprägnations-
methoden oder zu der Hoffnung, dereinst doch noch solche Endpunkte zu finden. Es ist
eben keine eng umgrenzte Endigung vorhanden, wie wir sie etwa in demperipheren Zügen
des; Zentralnervensystems vorfinden, sondern die Wirkung ist über eine große Fläche verteilt.
Solche flächenhaften Endgebilde durchziehen wie ein feiner Schleier sämtliche zu
innervierenden Gewebe, und wie wir sehen, bleibt da kaum noch ein Gewebe übrig; ist
diese autonome Innervation nun durch diese Untersuchung doch sogar für das Epithel der
Haut nachgewiesen. Meines Wissens bestehen |ftz t Zweifel über das Vorhandensein einer
autonomen Innervation n ur noch beim Knorpelgewebe, wo die Verhältnisse noch nicht
ganz geklärt sind, aber auch das wird wohl nur noch eine Frage der Zeit sein.
Noch wichtiger, was die Innervation des Bindegewebes betrifft, sind Fasern ganz feinen
Kalibers, die man gelegentlich in der Unterhaut antreffen kann. Ich zeige zwei solche
Fäserchen in den Abb. 19 und 20. Die Abb. 19 zeigt eine BindegCwebsstelle, die von einer
Nervenfaser durchlaufen wird. Die Lage der Faser ist, wie Viele a n d e r e Schnitte beweisen,
sehr deutlich festzustellen. Die Nervenfaser liegt mit Sicherheit intrazellulär. Sie weist
viele variköse Auflockerungen auf, vor allem auch in der nächsten Nähe des Kerns. Etwa
dasselbe Bild zeigt die nächste Zeichnung (Abb. 20). Eine Nervenfaser zieht durch zwei
Bindegewebszellen hindurch, deren Zellkerne zu sehen sind. Wieder sind sehr viele Varikositäten
vorhanden, die hier sogar eine besondere Größe und Gestalt erreichen. Bei den
Varikositäten des rechten Teiles der Nervenfaser sieht es so aus, wie wenn sich die Faser
nach der einen oder anderen Seite in das Gewebe hinein auflöst. Die eine Seite der Vari